











 |
 |
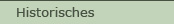 |
 |
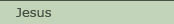 |
 |
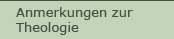 |
 |
|
Der frz.
Schriftsteller Gemeinschaftlicher Wahnsinn hört auf Wahnsinn zu sein und wird Magie. Wahnsinn nach Regeln und vollem Bewusstsein. Der
frühromantische Dichter Das Dogma ist nichts anderes als ein ausdrückliches Verbot zu denken. Der Philosoph Aus Leidenschaften werden Meinungen, die Trägheit des Geistes lässt diese zu Überzeugungen erstarren. Der
Philosoph Das ganze spekulative Gebäude der christlichen Glaubenslehre ruht auf den zu Dogmen erhobenen Missverständnissen einer naiven Daseinsinterpretation. Der Philosoph und Schriftsteller Gerhard Szczesny (1918-2002) Schon seit langem ist mir klar, dass wir heraussteigen müssen aus der Rumpelkammer des kirchlichen Dogmatismus. Der
slowak. ev. Theologe Dogmen sind Vorurteile mit Heiligenschein. Sie sind die den Schwachen aufgepfropften Meinungen der Starken. In der griechischen Welt, die wir geerbt haben, sind Dogmen nicht in erster Linie religiös; sie sind der Überbau eines geistigen Imperialismus. Ihr Hauptzweck ist nicht Wahrheit, sondern Ordnung, Weltordnung. Sie zielen darauf ab, Neuerungen zu ersticken, alle Traditionen außer einer zum Schweigen zu bringen. Seit Nicäa nehmen Christen an, die Wahrheit könne bei wichtigen Treffen wichtiger Leute definitiv vereinbart werden. Der brit. Autor und
kath. Theologe Dogmen werden von Offenbarungsreligionen mit dem Anspruch tradiert, absolute, in sich geschlossene und daher unbezweifelbare Wahrheit zu sein. Sie verbreiten den Anspruch, die ganze Wahrheit oder zumindest die für Menschen erreichbare Wahrheit ganz zu kennen. Die Einsicht, dass Dogmen zeitbedingte Antworten auf zeitbedingte Fragen gegeben haben und daher notwendig vorläufige Aussagen sind, passt in dieses Konzept nicht. Denn es akzeptiert ja die geschichtlichen Bedingungen unserer Wahrnehmungen nicht. Der Theologe Klaus-Peter Jörns (*1939) Auschwitz, die sowjetischen Gulags oder die »Killing Fields« von Kambodscha sind keine Beispiele für etwas, das geschieht, wenn sich der Mensch von Vernunft leiten lässt. All diese Schrecken bezeugen, wie gefährlich politischer und rassischer Dogmatismus ist. […] Das Problem mit der Religion ist dasselbe wie das Problem mit dem Nazismus, Stalinismus oder irgendeiner anderen totalitären Mythologie: Es ist ein Problem des Dogmas per se. (S. 65) Der amerik.
Philosoph und Schriftsteller
|
|
|
Dogmen und andere Glaubensmeinungen
![]()
Inhalt
- Vorbemerkungen
- Erstes Konzil von Nicäa (325)
- Erstes Konzil von Konstantinopel (381)
- Konzil von Ephesos (431)
- Die "Räubersynode" von Ephesos (449)
- Konzil von Chalcedon (451)
- Das Filioque-Problem (589)
- Versuch
einer kritischen Würdigung
- Vergottung des Menschen Jesu zur antik-hellenistischen Gottheit Christus
- Die Trinität – Dreieinigkeit Gottes?
- Die Trinitätslehre – "religiöse Lyrik"?
- Die Trinität – "Antwort auf Marcion"?
- Dogmen – unbezweifelbare Wahrheiten?
- Das Zeitalter der Dogmenbildung – beherrscht vom "Geist der Lüge"
- Dogmen – Instrumentalisierte Glaubensmeinungen
- Dogmen – Rechtsgrundlage für die Verfolgung von Häretikern
- Differenzierung kontra Uniformierung
- Dogma oder Dogmatiker im heutigen Sprachgebrauch
- Schlussbemerkungen
![]()
Vorbemerkungen
Es besteht nicht die Absicht an dieser Stelle eine ausführliche Geschichte der Dogmenentstehung auszubreiten. Wer sich intensiver mit diesem Themenkomplex befassen möchte, sei auf einschlägige theologische Werke verwiesen, z. B. auf die Dogmengeschichte von Wolfgang A. Bienert, die Geschichte des Christentums in Grundzügen von Bernd Moeller, Die Entstehung des christlichen Dogmas von Martin Werner oder die Dogmengeschichte von Adolf von Harnack. Im Rahmen dieser Website erscheint es als angemessen und machbar, nach dem Versuch einer Begriffsklärung, die Orte und Zeitpunkte der Beschlüsse der wesentlichen christlichen Dogmen und ggf. abweichende zeitgenössische Gegenpositionen darzustellen. Danach folgt ein weiterer Versuch, der Versuch einer kritischen Würdigung.
Was heißt Dogma?
Nach
dem Duden stammt der Begriff aus dem Griechischen
und bedeutet (in der Kirchenlehre) Glaubenssatz
oder Lehrmeinung. – Wolfgang
A. Bienert
verweist auf die "ursprüngliche Bedeutung" des Begriffes
– »das, was als richtig erschienen ist«".
Nach Darstellung einiger Entwicklungsschritte seit dem frühen
Christentum schließt er seine Begriffsklärung mit
Hinweisen auf das heute vorherrschende Verständnis in den
beiden wesentlichen christlichen Konfessionen. In der
römischen Konfession wurde es mit dem Ersten Vatikanischen Konzil (1870)
"... zur amtlich verfügten und damit verfügbaren Kirchenlehre und Glaubensvorschrift. – Für evangelisches Verständnis formuliert dagegen der Lutheraner W. Elert: »Dogmen sind Kirchenlehren. Sie beruhen auf der Glaubenserkenntnis der christlichen Kirche. Nach evangelischem Verständnis sind sie nicht Glaubensdekrete, sondern Glaubensbekenntnisse. Sie sagen nicht, was geglaubt werden soll, sondern was geglaubt wird«."
Was das Dogmenverständnis der römischen Konfession angeht, ist der obige knappe Hinweis eines protestantischen Theologen auf die Definition des Ersten Vatikanischen Konzils vielleicht doch zu wenig. Ein Blick in den Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) vermittelt ein wesentlich klareres Bild. Unter der Überschrift Die Dogmen des Glaubens heißt es in den Artikeln 88 und 89:
"88 Das Lehramt der Kirche setzt die von Christus erhaltene Autorität voll ein, wenn es Dogmen definiert, das heißt wenn es in einer das christliche Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichtenden Form Wahrheiten vorlegt, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind, oder auch wenn es auf endgültige Weise Wahrheiten vorlegt, die mit diesen in einem notwendigen Zusammenhang stehen.
89 Unser geistliches Leben und die Dogmen stehen in organischer Verbindung. Die Dogmen sind Lichter auf unserem Glaubensweg, sie erhellen und sichern ihn. Umgekehrt werden durch ein rechtes Leben unser Verstand und unser Herz geöffnet, um das Licht der Glaubensdogmen aufzunehmen [Vgl. Joh 8, 31–32] (Vgl. dazu auch 2625)."
Anmerkungen
- Hervorhebungen im KKK-Zitat
stammen vom Autor der Site.
- Beim Lesen dieses Textes römischer Herkunft frage ich mich,
was daraus über den "Stellvertreter" und seine Vasallen, die
das "Lehramt der Kirche" bilden, zu erfahren ist: Mir springen
insbesondere ihre erschreckenden Defizite an intellektueller
Redlichkeit, ihre geradezu unerschöpfliche Fantasie und ihre
nicht zu überbietende Chuzpe ins Auge.
Die
wesentlichen christlichen Dogmen
In der einschlägigen Literatur werden
zwei grundlegende Dogmen genannt, das »trinitarische«
und das »christologische«
Dogma. Wolfgang
A. Bienert
benennt darüber hinaus noch ein drittes, das »pneumatologische«
Dogma, das die Gottheit des Heiligen Geistes betrifft. Die Berechtigung
der einen oder der anderen Dogmenstruktur wird hier nicht untersucht.
Anmerkungen
- Diese Dogmenstruktur findet sich in der einschlägigen
theologischen Literatur des protestantischen Teils des organisierten
Christentums.
- Im Schrifttum und in der Glaubenspraxis der
römischen Konfession spielen darüber hinaus noch
eine große Zahl weiterer Dogmen eine wichtige Rolle (z. B. div.
Mariendogmen, Dogma der
Unfehlbarkeit des Papstes). Der Autor Walter Gerhardt hat insgesamt
245(!) Dogmen der römisch-katholischen Kirche dokumentiert (s. hier). Bemerkenswert ist: Der Zölibat kommt in dieser Liste nicht vor.
Orte
und Zeitpunkte der Festlegung der Dogmen
Schon im Urchristentum gab es
Zusammenkünfte, auf denen Vereinbarungen über
wichtige christliche Glaubensmeinungen getroffen wurden. Als wohl erste
dokumentierte Zusammenkunft dieser Art gilt das sog. "Apostelkonzil", das zwischen 44
und 49 n. Chr. in Jerusalem stattfand. Vertreter der Jerusalemer
Urgemeinde, u. a. Petrus und Jakobus, trafen sich damals mit Paulus.
Kirchliche Versammlungen wurden und werden meist als Synoden bezeichnet. Es hat sich wohl im Laufe der Kirchengeschichte eingebürgert, besonders wichtige Synoden synonym als Konzile oder Konzilien zu bezeichnen. Heute werden die wichtigsten kirchlichen Versammlungen, die ab dem frühen 4. Jahrhundert die entscheidenden Beschlüsse über die grundlegenden christlichen Dogmen fassten, auch "Ökumenische Konzile" genannt, weil die Ergebnisse, in ihrer Gesamtheit oder zumindest in Teilen, noch heute von den unterschiedlichen christlichen Konfessionen anerkannt werden. Im Wesentlichen geht es in diesem Zusammenhang um vier Versammlungen: in Nicäa (325), Konstantinopel (381), Ephesos (431) und Chalcedon (451).
![]()
Erstes
Konzil von Nicäa (325)
Nicht zuletzt der sog. arianische Streit, dem nicht nur theologische Meinungsverschiedenheiten, sondern auch persönliche Rivalitäten zwischen dem Bischof von Alexandrien, Alexander (†328), und dem Presbyter Arius (260-336) zugrunde lagen, veranlasste Kaiser Konstantin (272/285-337), ein Konzil nach Nicäa einzuberufen. Der Kaiser tat dies aus purem Machtkalkül. Ihm war daran gelegen, destabilisierende Entwicklungen in der zunehmend erstarkenden Kirche, die zur gesellschaftlichen Destabilisierung des Römischen Reiches hätten beitragen können, möglichst schon im Keime zu ersticken.
Worum ging es im
"arianischen Streit"?
Schon mit Paulus, also seit Mitte des 1. Jahrhunderts, begann der
Prozess der Vergottung des Menschen Jesu zum antik-hellenistischen Gott
Christus (s. Menüpunkt
Jesus). Im Laufe des 2. Jahrhunderts wurde die Gottheit Jesu
wohl zu einem weitestgehend anerkannten Faktum. Dennoch gab es keine
einhellige Meinung über die genaue Ausprägung seiner
Göttlichkeit, insbesondere in Beziehung und/oder in Abgrenzung
zu dem »einen und einzigen« Gott, dem Vater. Von Origenes
(185-254) war "zwar die enge Zusammengehörigkeit der drei Hypostasen Vater,
Sohn und Geist festgestellt worden, doch war offen geblieben, wie das
Rangverhältnis zwischen ihnen zu denken sei" (Bernd Moeller).
In den ersten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts eskalierten dann die Auseinandersetzungen – das Vater-Sohn-Verhältnis betreffend – zwischen den maßgeblichen Köpfen der damaligen Kirche. Es kristallisierten sich zwei wesentliche Standpunkte heraus, die sich, vereinfacht, etwa so definieren lassen: Bischof Alexander und Gesinnungsgenossen vertraten die Auffassung, Jesus Christus sei "eines Wesens mit dem Vater" (Homoousie). Arius hingegen war der Überzeugung, dass "der Sohn vom Vater trotz aller Sonderstellung, die ihm innerhalb der Welt der Geschöpfe zukommt, wesenhaft getrennt" sei (Wolfgang A. Bienert).
Ergebnis
Auf dem ersten
Konzil von Nicäa erreichten das "trinitarische" und
das "christologische"
Dogma einen wichtigen Meilenstein. Das "christologische",
dass sich mit der Gottheit
Christi befasst, hatte dabei wohl das
größere Gewicht. In dem auf Druck Kaiser Konstantins zu Stande gekommenen
und beschlossenen Glaubensbekenntnis (Nicänum) spiegelte sich
der Sieg der Ariusgegner (»eines Wesens mit dem
Vater«). Dem Glaubensbekenntnis wurde eine Verurteilung
derjenigen angefügt, die etwas anderes lehrten. Die Arianer
wurden nicht explizit genannt, waren aber gemeint. Der Beschluss einer
vorausgehenden Synode, die Arius
schon 324 zum Ketzer erklärt hatte, wurde bestätigt.
Der Besitz arianischer Schriften wurde mit der Todesstrafe bedroht!
Anmerkung
Der Theologe und Historiker Gottfried
Arnold (1666-1714) hat, in der barocken Sprache des
ausgehenden 17. Jahrhunderts, sehr eindrücklich beschrieben,
welche Konsequenzen Andersdenkenden drohten (s. hier).
Der
"arianische
Streit" schwelte dennoch weiter
Der spätere Nachfolger des Bischofs Alexander, Athanasius (295-373), vertrat die
Überzeugung, "Jesus, der Retter der Welt und aller Menschen,
konnte nicht selbst ein erlösungsbedürftiges
Geschöpf sein. Wenn Arius aus Jesus ein Geschöpf
machte, raubte er der Menschheit den Erlöser." (s. hier)
Der reformierte Theologe Martin Werner (1887-1964) beschreibt in seinem Buch Die Entstehung des christlichen Dogmas die Ursachen für die "Wirren des arianischen Streits":
"Der tiefste Grund aller Schwierigkeiten, Verlegenheiten und Sophistereien dieser Situation ist das Misslingen des Schriftbeweises. Keine der streitenden Parteien vermag zur Lösung des Problems des Ausgleichs zwischen uneingeschränktem Monotheismus und Unterscheidung der Eigenpersönlichkeit des Sohnes vom Vatergott aus der heiligen Schrift ein sicheres, einleuchtendes und durchschlagendes Argument zu gewinnen."
![]()
Erstes
Konzil von Konstantinopel (381)
Der arianische Streit (s. o.) war auch Jahrzehnte nach dem bedeutenden Konzil von Nicäa nicht entschieden. Ganz im Gegenteil: Unter den Nachfolgern des Kaisers Konstantin gab es solche, die mit der Lehre der "Arianer" sympathisierten. Seit 379 regierte Theodosius I. den Osten des Römischen Reiches. Er hatte sich auf die Seite der Arius-Gegner gestellt, die das Nicänum, das in Nicäa verabschiedete Glaubensbekenntnis, als alleinige Basis des christlichen Glaubens anerkannten. Theodosius ist auch als der Kaiser in die Geschichte eingegangen, der im Jahre 380, zusammen mit Gratian, dem Kaiser im Westen und dessen Mitkaiser Valentinian II., per Edikt (cunctos populos) das Christentum zur Staatsreligion und die Kirche zur Reichskirche erhob. Gleichzeitig wurden alle, die den "trinitarischen" Glauben nicht anerkannten, zu Häretikern erklärt und mit Strafen bedroht.
Der Streit zwischen den "Trinitariern", wie die Arius-Gegner auch genannt werden, und den "Arianern" nahm Anfang der achtziger Jahre des 4. Jahrhunderts offenbar bedrohliche Formen an. Theodosius I., der wohl der Gefahr einer möglichen Kirchenspaltung vorbeugen wollte, berief daher 381 eine regionale Kirchensynode nach Konstantinopel ein, die Klarheit bringen sollte. Diese Synode wurde wegen ihrer grundlegenden Bedeutung für das christliche Glaubensgut im Nachhinein zum zweiten ökumenischen Konzil aufgewertet.
Ergebnis
In Konstantinopel bildete wahrscheinlich das Nicänische Glaubensbekenntnis
die Ausgangsbasis. Es wurde bestätigt, ergänzt und
neu gefasst. Während in Nicäa die "Festschreibung"
der Gottheit Christi das wichtigste Teilergebnis war, ist es hier die
abschließende "Festlegung" der Gottheit des Heiligen Geistes.
Im Nicänum kam der Heilige Geist nur in einem kurzen
Schlusssatz vor, im Glaubensbekenntnis von Konstantinopel wird ihm
deutlich mehr Raum gegeben. Das "trinitarische" Dogma
(inkl. seines "pneumatologischen"
Teilaspektes) fand hier seine endgültige Form. – Bernd
Moeller: "Die Lehre
von der Trinität ist das erste eigentliche
»Dogma« der Kirche, und es ist für die
Dauer ihr Grunddogma geblieben."
Sowohl vom Konzil in Nicäa als auch von dem in Konstantinopel sind weder Akten noch Protokolle überliefert. Daher kennt man den Wortlaut der Bekenntnisse erst aus den Dokumenten des Konzils von Chalcedon, dem 4. ökumenischen Konzil (s. unten). Hierin ist der Grund dafür zu suchen, dass die Entstehungsgeschichte der Bekenntnisse bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte. Seit dem 17. Jahrhundert wird das Bekenntnis von Konstantinopel als "Nicäno-Konstantinopolitanum" bezeichnet (Wolfgang A. Bienert).
Der auf diesem Konzil endgültig verworfene "Arianismus" hat sich in den Kerngebieten der damaligen Kirche nicht länger halten können. Nur bei den Goten und Vandalen überdauerte die arianische Glaubensrichtung noch einige Jahrhunderte.
![]()
Konzil
von Ephesos (431)
Die Streitigkeiten zwischen den führenden Theologen der damaligen kirchlichen Machtzentren Alexandria, Antiochia, Konstantinopel und Rom über Teilaspekte des "christologischen" Dogmas gingen weiter. Die Auseinandersetzungen, auch nestorianischer Streit genannt, kulminierten in der Zeit zwischen 428 und 431. In 428 wurde Nestorius (nach 381-um 451), ein Mann aus Antiochia, Bischof von Konstantinopel. Er stand für eine »Zwei-Naturen-Lehre« bezogen auf die "Person" Christi: "Nicht eine Einheit von Gottheit und Menschheit, sondern nur ein Verhältnis beider zueinander sei anzunehmen" (Bernd Moeller). Die Gegenposition ist mit dem Namen Kyrills, des Patriarchen von Alexandria, verknüpft. Von ihm "wurde die »physische bzw. hypostatische Einung« der Naturen hervorgehoben" (Wolfgang A. Bienert).
Der damalige Papst Coelestin I. unterstützte die alexandrinische Position und gab Kyrill, "dem mächtigen und bis zur Gewalttätigkeit skrupellosen Patriarchen" (Bernd Moeller) den Auftrag, die Angelegenheit zu klären. Eine 430 nach Alexandria einberufene Synode verurteilte unter der Leitung Kyrills die antiochenische Position. Darüber hinaus wurde Nestorius aufgefordert, die mit der alexandrinischen Christologie verbundene Vorstellung von der Rolle der Maria als »Gottesgebärerin« anzuerkennen. Nestorius, der, aus seiner Sicht folgerichtig, allenfalls die Bezeichnung »Christusgebärerin« akzeptieren konnte, beugte sich den Forderungen nicht.
Um doch noch eine Einigung zwischen den Vertretern der gegensätzlichen Glaubensmeinungen zu erreichen, berief Kaiser Theodosius II. 431 eine Synode nach Ephesos ein. Dort "ging es dramatisch zu" (Wolfgang A. Bienert), "kam es zu allerlei tumultuarischen Szenen und schließlich zu einer Spaltung der beiden Parteien, die sich gegenseitig verdammten" (Bernd Moeller). Dann geschah etwas, was nur als kurios bezeichnet werden kann: Der schwache Kaiser, der zunächst seinen Bischof Nestorius unterstützt hatte, ließ sich dazu hinreißen,die Konzilsentscheidungen beider(!) Parteien anzuerkennen. Darüber hinaus ließ er die führenden Köpfe beider Gruppen gefangen setzen:
"So war die Lage ganz verworren, und sie wurde dadurch nicht durchsichtiger, dass Cyrill aus dem Gefängnis entfliehen konnte und sich 433 bereit fand, zusammen mit seinen Gegnern eine »Unionsformel« zu unterzeichnen, in der er wesentliche Zugeständnisse machte. Nestorius hätte diese Formel durchaus unterschreiben können. Doch blieb er abgesetzt und verbannt, und die Teilsynode Cyrills von 431 wurde das dritte heilige Konzil nach Nicäa und Konstantinopel. Deutlich hatte sich der theologische Stil gewandelt. Das Denken in Namen und Schulen statt mit Argumenten begann überhand zu nehmen" (Bernd Moeller).
Ergebnis
Das wichtigste Ergebnis der "Teilsynode Cyrills
von 431" war wohl die Festlegung der Rolle der Maria als »Gottesgebärerin«,
und es ist bekannt, "das riesige Bestechungsgelder mitentschieden, die
der Patriarch von Alexandrien, der hl. Kyrill, allen möglichen
Leuten zuschob" (Karlheinz
Deschner). Zum "christologischen" Dogma bzw. zu Teilaspekten
davon brachte das Konzil von Ephesos keine
Klärung, und die danach, im Jahre 433 gefundene
"Einigungsformel" war wohl auch nur als vorläufig zu
betrachten.
Es kam übrigens nicht von ungefähr, dass gerade in Ephesos die Diskussion um Maria eine so große Rolle spielte: Ephesos war ein "Zentrum altkirchlicher Marienverehrung" (Wolfgang A. Bienert). Dies verwundert nicht, war Ephesos doch vorher ein Zentrum glühender Verehrung der (Fruchtbarkeits-)Göttin Artemis, deren berühmter Tempel, eines der sieben Weltwunder, sich dort befand und zwar bis zu seiner Zerstörung durch die Goten im Jahre 262 n. Chr.
Nach dem Konzil gründeten Parteigänger des Nestorius eine eigene Kirche, deren Zentrum im damaligen Sassanidenreich lag. Diese Kirche wurde häufig als nestorianische Kirche bezeichnet. Da ihre Lehre mit der des Nestorius jedoch kaum etwas zu tun hatte, trifft wohl eher die ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung assyrische Kirche des Ostens zu. Bemerkenswert ist, dass diese Kirche Missionsaktivitäten bis nach Indien, China, Japan und Indonesien entfaltete. Sie wurde erst im 14. Jahrhundert von muslimischen Mongolen weitgehend zerstört. Reste dieser Kirche gibt es noch heute im Nahen Osten.
Anmerkung
Das erste schismatische Ereignis im frühen
Christentum war von Markion schon im 2. Jahrhundert ausgelöst
worden. Er gründete um 144 die markionitische Kirche,
die in Ägypten und Persien noch bis ins 6. Jahrhundert
existierte. Gemessen an diesem frühchristlichen Geschehen,
verursachte das Ergebnis von Ephesos wohl eine noch bedeutendere
Abspaltung von Verfechtern abweichender Glaubensmeinungen von der
damaligen Reichskirche.
![]()
Die
"Räubersynode" von Ephesos (449)
Im Jahre 444 starb Kyrill von Alexandria. Dieses
Ereignis führte zum Wiederaufflammen des schwelenden Streites
über das christologische Dogma: Es entzündete sich
der sog. eutychianische
Streit (448-450).
Namensgeber war Eutyches,
ein Klostervorsteher in
Konstantinopel, der konsequent die Position Kyrills (s. o.) vertrat.
Mit dem Namen Eutyches ist der Begriff des Monophysitismus eng verbunden,
eine Glaubensmeinung, die nur eine einzige,
und zwar die göttliche Natur Christi anerkennt.
Einen Eindruck von den Macht- und Ränkespielen im Zusammenhang mit den "eutychianischen" Streitigkeiten auf den Konzilien der späten Vierzigerjahre des 5. Jahrhunderts vermittelt Wolfgang A. Bienert in seiner Dogmengeschichte:
"Eutyches war zunächst von einer Synode in Konstantinopel unter Leitung des Ortsbischofs Flavian (448) verurteilt worden. Kurz darauf rehabilitierte ihn ein Konzil in Ephesus (449). Dieses wurde von Dioskur, dem Nachfolger Kyrills, beherrscht, der zu dieser Zeit enge Beziehungen zum kaiserlichen Hof in Konstantinopel unterhielt. Anstelle des Eutyches wurde nun Flavian, der Bischof von Konstantinopel, abgesetzt und in die Verbannung geschickt, wo er kurz darauf starb".
Dioskur hatte die eutychianische Position mit Hilfe von Soldaten sowie syrischen und ägyptischen Mönchshorden gewaltsam durchgesetzt. Wegen dieser Gewalttätigkeiten, aber wohl auch deshalb, weil das Ergebnis nicht mit seiner christologischen Glaubensmeinung übereinstimmte, nannte der damalige Bischof von Rom, Papst Leo I., diese Synode "Räuberversammlung". Seine gegensätzliche christologische Auffassung, die Christus zwar eine Person aber zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche, zuschrieb, war mit der Position, die Eutyches und Dioskur vertraten, nicht vereinbar.
![]()
Konzil
von Chalcedon (451)
Im Jahre 450 kam Kaiser Theodosius II. bei einem Jagdunfall ums Leben. Sein Nachfolger, Markian, ließ in 451, nicht zuletzt auf Betreiben seiner Frau Aelia Pulcheria, der Schwester seines Vorgängers, ein weiteres Konzil einberufen, und zwar nach Chalcedon. Auf diesem Konzil wurde nun Dioskur, der die "Räubersynode" von Ephesos in 449 (s. o.) beherrscht hatte, abgesetzt und in die Verbannung geschickt.
Ergebnis
Auf dem Konzil von Chalcedon wurden die
Glaubensformeln von 325 und 381 bestätigt und durch
ergänzende Formeln präzisiert. Das sog. Chalcedonense ist kein neues
Glaubensbekenntnis, sondern erscheint eher als so etwas wie ein um
abschließende Klärung bemühter Kommentar.
Seine, zum Dogma erhobene, Kernaussage lautet kurz gefasst: Der Gott
Christus ist eine einzige
Person bzw. Hypostase,
die zwei
Naturen besitzt, eine göttliche
und eine menschliche,
"die jedoch weder miteinander vermischt oder
ineinander verwandelt noch geschieden
oder getrennt sein sollten" (Bernd Moeller). Mit dieser
dogmatischen Lehrformel wurde die 449 vorherrschende "eutychianische"
bzw. "monophysitische" Position, die Christus nur eine
einzige Natur und zwar eine göttliche
zuschrieb, endgültig verurteilt.
Nach Wolfgang A. Bienert gilt die christologische Formel des Konzils von Chalcedon "als Abschluss der Entstehungsgeschichte des christologischen Dogmas und oft als Abschluss der altkirchlichen Dogmengeschichte insgesamt".
Kirchenhistoriker messen diesem Konzil darüber hinaus noch eine goße kirchenpolitische Bedeutung mit Langfristwirkung bei:
- Das sog. Ökumenische Konzil setzte sich als höchstes Entscheidungsorgan über Fragen kirchlicher Lehre durch.
- Der Primat des Bischofs von Rom wurde weitgehend anerkannt. Das lag nicht zuletzt an der Persönlichkeit des amtierenden Papstes Leo I. Er war wohl "der erste bedeutende Bischof von Rom seit 200 Jahren" (Bernd Moeller).
- Die bei den entscheidenden Beschlüssen unterlegenen Vertreter der ägyptischen Kirche bzw. der alexandrinisch-kyrillischen Glaubensmeinung empfanden das Chalcedonense als zu "nestorianisch" (s. o.) und wollten sich ihm nicht beugen. "Es kam zur Spaltung der Kirche und zur Entstehung einer selbständigen ägyptischen (»koptischen«) Kirche." Weitere "nicht-chalcedonensische" Kirchen bildeten sich unter Syrern, Armeniern und Äthiopiern. Wolfgang A. Bienert stellt weiter fest: "Christliche Identität wird nun zu einer konfessionell bestimmten Identität."
![]()
Das
Filioque-Problem (589)
Nach 451 gingen die Streitigkeiten um das christologische Dogma noch bis weit in das 6. Jahrhundert hinein weiter. Die in Chalcedon erreichte Grundstruktur dieses Dogmas wurde zwar nicht mehr geändert, es wurden jedoch "weitere Differenzierungen und Präzisierungen hinzugefügt" (Bernd Moeller).
In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts wurde im Westen der damaligen Reichskirche eine folgenschwere Entscheidung über eine Präzisierung des pneumatologischen Teils des trinitarischen Dogmas getroffen: In 589, auf dem dritten Konzil von Toledo, wurde das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel ergänzt. Betroffen war die Aussage über die Herkunft des Heiligen Geistes.
Der entsprechende Textteil mit der Ergänzung von Toledo lautet:
|
»…
|
»…
|
Das Filioque war vermutlich nicht ursächlich, wohl aber ein wichtiger theologischer Aspekt im Prozess der seit dem 5. Jahrhundert fortschreitenden Entfremdung zwischen den östlich-orthodoxen Kirchen und der westlichen römisch-katholischen Kirche. Diese Entfremdung führte schließlich zum Morgenländischen Schisma (auch als Großes Schisma bekannt), zur Trennung der maßgeblichen christlichen Konfessionen. Als entscheidendes Datum für diese Trennung wird meist das Jahr 1054 angegeben. Damals haben sich der Bischof von Rom (Papst Leo IX.) und der Patriarch von Konstantinopel (Michael I.) gegenseitig exkommuniziert.
Die Orthodoxe Kirche hat das Filioque nie anerkannt. Die Katholische Kirche erhob es im Jahre 1215 (4. Laterankonzil) offiziell zum Dogma.
Anmerkung
Mir als Nichtlateiner erschien die Wortkonstruktion filioque als sonderbar: Das Bindewort
und wird in der
Endsilbe eines Wortes abgebildet. Ich verstand es besser als ich mir
das Hoheitszeichen SPQR
des antiken Roms im Volltext vergegenwärtigte: Senatus
Populusque
Romanus
(Senat und Volk von Rom).
![]()
Versuch
einer kritischen Würdigung
Nach einer kurzen Betrachtung der zwei christlichen Grunddogmen – Gottheit Christi und Trinität – und nach Darstellung der kritischen Haltung einiger Autoren zu diesen tradierten Glaubensmeinungen, richtet sich das Augenmerk u. a. auf die "Instrumentalisierung" der auf den Konzilien beschlossenen Dogmen durch die jeweiligen Machthaber des organisierten Christentums.
Vergottung des Menschen Jesu zur
antik-hellenistischen Gottheit Christus Die
Vordenker des frühen Christentums konnten auf Vorbilder bzw.
auf Modellvorstellungen von Gottheiten zurückgreifen, die in
älteren Religionen, insbesondere aber in den damals bekannten
Mysterienkulten, schon lange vor unserer Zeitrechnung, entwickelt
worden waren. Folgerichtig finden sich in der Biografie des
christlichen Gottes Christus viele biografische Details anderer antiker
Götter (z. B. von Asklepios,
Dionysos und Mithras).
In seinem Buch Die Entstehung des christlichen Dogmas zitiert der Theologe Martin Werner (1887-1964) den frühchristlichen Theologen Justin (um 100-165):
"..., sagt doch bezeichnenderweise sogar dieser philosophisch gebildete Theologe schließlich seinen Lesern geradewegs heraus: »Im Vergleich mit euren Erzählungen von Söhnen des Zeus bringen wir nichts Neues vor.« Dann zählt er auf: Hermes, Asklepios, Herakles usf."
Es war von allem Anfang an das erklärte Ziel der frühchristlichen Autoren einen Gott zu beschreiben, der allen anderen Göttern mindestens ebenbürtig war, um mit ihnen konkurrieren zu können. Nur als Gott konnte Christus den Gläubigen der neuen Religion glaubwürdig jene »Erlösung« verheißen, die auch von den Gottheiten anderer Religionen in Aussicht gestellt wurden. Chancengleichheit auf dem Markt des sakralen Wettbewerbs um die Gunst der Gläubigen war das erklärte Ziel der "Marketingstrategen" des frühen Christentums.
Im nachfolgenden Prozess der Dogmenentwicklung wurde die »Kunstfigur« des Gottes Christus von den frühchristlichen Vordenkern stetig weiterentwickelt. Sie definierten dabei die Eigenschaften ihres Gottes immer präziser. Zunehmend bildete sich bei ihnen die Vorstellung aus, dass er den anderen Göttern keineswegs nur ebenbürtig, sondern weit überlegen war. Sie empfanden es nicht als anmaßend, dem von ihnen erfundenen Gott u. a. den Titel »Pantokrator« zu verleihen, was etwa Weltherrscher oder Herrscher über die ganze Welt und den gesamten Kosmos bedeutet. Und als das organisierte Christentum schließlich die nötigen Machtmittel besaß, war ihm die erreichte Chancengleichheit bei weitem nicht genug. Vielmehr ging es umgehend daran, seine Glaubensmeinung im gesamten Römischen Reich brutal durchzusetzen - eine Glaubensmeinung von geradezu größenwahnsinnigem Zuschnitt.
Die Theologin Uta Ranke-Heinemann (*1927) reflektiert in ihrem Buch Nein und Amen die Ergebnisse der "für das Märchengebäude des Christentums grundlegenden Konzilien". Das Konzil von Nicäa (325) hatte entschieden, "dass auch der Sohn Gott ist und genauso alt, d. h. genauso ewig wie sein Vater." Die daraus abgeleitete Tradition der Kirchen stellt sich ihr so dar:
"Inzwischen haben die Christen überhaupt keine Probleme mehr damit, dass nun alle Weihnachten Gott als Säugling in Windeln in der Krippe liegt. Im Gegenteil. Die Säuglingswerdung Gottes kommt ihrer infantilisierenden Theologie, die aber auch wirklich alles für möglich hält, sogar entgegen, dank dem Einsatz der Universal-Waffe gegen jeden Funken Verstand: »Bei Gott ist kein Ding unmöglich«, einer Zauberformel, die noch nie versagt hat, den Christen auch auf verlorenstem Posten ihr Gefühl der Überlegenheit über die menschliche Vernunft zu belassen, denn je größer die Beschädigung der Vernunft, desto stärker die Macht des Glaubens."
Das Christologie-bezogene Resultat des Konzils von Chalcedon (451), das einen vorläufigen Abschluss der seit Nicäa (325) anhaltenden Auseinandersetzungen markierte, ist für Ranke-Heinemann (*1927) die "Krönung der Jesuslegende":
"Mit diesem Höhepunkt, dieser Krönung der Jesuslegende, dieser Quadratur des Kreises auf dem 4., dem Konzil von Chalcedon: »Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch«, enden diese ersten vier allgemeinen christlichen Konzilien, die als die für alle Christen – d. h. für Katholiken, Protestanten und Orthodoxe – wichtigsten Konzilien gelten, als die für alle Christen verbindliche Auslegung der biblischen Botschaft, womit das jahrtausendelange Rätselraten, wie kann ein Mensch Gott, und wie kann ein Gott Mensch sein, erst eigentlich beginnt und niemals mehr enden wird."
Uta Ranke-Heinemann hatte bei ihren vorgenannten Überlegungen wohl insbesondere die "landläufige katholische Primitivtheologie" vor Augen. M. E. unterscheidet sich die gängige protestantische Theologie, in Bezug auf die eben angesprochenen dogmatischen Glaubensmeinungen, jedoch kaum von dieser römischen Variante.
Für den Philosophen Walter Kaufmann (1921-1980) liegt in der Vergottung Jesu die entscheidende Differenz zwischen Judentum und Christentum:
"In Israel ist niemals ein Mensch angebetet oder auch nur zum Halbgott erhoben worden. Dies ist eine der außergewöhnlichsten Tatsachen der Religion des Alten Testaments und bei weitem der wichtigste Grund, warum die Juden das Christentum und das Neue Testament ablehnen."
Für die Menschen der hellenistischen Spätantike, die Menschen jüdischen Glaubens ausgenommen, war es wohl nicht besonders schwierig, die dem Menschen Jesu zugeschriebene Göttlichkeit unkritisch hinzunehmen. Es machte ihnen wohl auch keine große Mühe, Aussagen über das Wesen oder über Eigenschaften dieser göttlichen "Person" zu glauben, sie für "wahr" zu halten. Für mich ist es jedoch nicht verständlich, dass diese sehr leicht als zeitbedingte Produkte menschlicher Fantasie zu durchschauenden Glaubensmeinungen, aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, vom organisierten Christentum auch noch den Menschen des 21. Jahrhunderts als "Wahrheit" angedient werden. Auch wenn sich zeitgenössische Theologen hierbei höchst fantasievoller Interpretationen bedienen, können sie nicht verhindern, dass ihnen immer weniger Menschen zuhören und sich immer mehr Menschen von den Kirchen verabschieden.
Die Trinität
– Dreieinigkeit Gottes?
Auch bei der Entwicklung des christlichen
Trinitäts-Dogmas, das 381 in Konstantinopel verabschiedet
wurde, standen aus anderen Religionen entlehnte Modellvorstellungen
Pate. In der altägyptischen Mythologie gab es z. B. die
Dreiheit aus den Gottheiten Osiris,
Isis und Horus.
Karlheinz Deschner (1924-2014) nennt
in seinem
Buch Der
gefälschte Glaube noch weitere Vorbilder:
"Das ganze erste Jahrhundert kannte keine christliche Trinität. Wohl aber gab es eine Fülle von Götterdreiheiten: die Apis-Trinitätslehre und die Sarapis-Trinitätslehre, die Trinität der Dionysosreligion, die kapitolinische Trias, Jupiter, Juno, Minerva; es gab den dreimal großen Hermes, den dreieinigen Weltgott, von dem man glaubte, er sei »allein ganz und dreimal einer«, um aus der Vielzahl antiker Trinitäten nur einige zu nennen."
Die Theologen geben wissentlich oder unwissentlich vor, dass die christliche Ausprägung des monotheistischen Gottesbildes in Form der sog. Trinität schon im NT bezeugt sei. Dabei berufen sie sich gern auf den Missions- bzw. Taufbefehl in Mt 28, 18-20, nach meiner Kenntnis wohl die einzige Fundstelle im NT, in der die Begriffe Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeinsam auftauchen. Und genau diese Stelle ist eine Fälschung (s. hier). Es gibt noch eine andere Stelle, die im Zusammenhang mit der Trinität manchmal herangezogen wird, und zwar im als echt geltenden zweiten Brief des Paulus an die Korinther. In 2. Kor 13,13, im letzten Vers dieses Briefes, steht die bekannte Segensformel:
»13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen.«
Es findet sich jedenfalls in beiden Texten keinerlei Hinweis auf die Beziehung der drei genannten Denkfiguren zueinander. Ebenso wenig ist erkennbar, ob es sich um drei "Personen" handelt. Daher ist nicht nachvollziehbar, wie daraus die spätere "innere" Struktur des sog. "dreieinigen Gottes" konstruiert werden konnte. Dennoch schreibt z. B. der Theologe Wolfgang A. Bienert, dass sich der christliche Gott "nach dem Zeugnis der Bibel in drei Personen (Hypostasen) offenbart". Die intellektuelle Redlichkeit bleibt hier einmal mehr auf der Strecke (s. auch Feststellung des Theologen Martin Werner hier).
Der Philosoph Ludwig Feuerbach (1804-1872) beschäftigte sich in seinem Buch Das Wesen des Christentums ausführlich mit der Trinität. Seine Kritik ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten:
"Die Trinität ist der Widerspruch von Polytheismus und Monotheismus, von Phantasie und Vernunft, Einbildung und Wirklichkeit. Die Phantasie ist die Dreiheit, die Vernunft die Einheit der Personen. Der Vernunft nach sind die Unterschiednen nur Unterschiede, der Phantasie nach die Unterschiede Unterschiedne, welche daher die Einheit des göttlichen Wesens aufheben. Für die Vernunft sind die göttlichen Personen Phantome, für die Einbildung Wesen. Die Trinität macht dem Menschen die Zumutung, das Gegenteil von dem zu denken, was man sich einbildet, und das Gegenteil von dem sich einzubilden, was man denkt – Phantome als Wesen zu denken. [... ]
So löst auch in dem heiligen Mysterium der Trinität - inwiefern es nämlich eine vom menschlichen Wesen unterschiedne Wahrheit vorstellen soll – alles sich auf in Täuschungen, Phantasmen, Widersprüche und Sophismen."
Wie zur Vergottung Jesu (s. oben) hat die Theologin Uta Ranke-Heinemann (*1927) in ihrem Buch Nein und Amen auch zur Trinitätslehre Stellung bezogen:
"Mit ihren »drei Personen« des einen Gottes schufen sich die Christen nie zu lösende Denkprobleme gegenüber dem Monotheismus der Juden. Aber den Christen ist eine gedankliche Unlösbarkeit und eine unlösbare Gedankenlosigkeit nur Beweis ihres größeren Glaubens. Und evangelische und katholische Theologen gleichermaßen haben alle Hände voll zu tun, zu erklären, das der Begriff »Personen« bei der Dreifaltigkeit nicht in dem Sinne von »Personen« zu verstehen ist, wie ihn jedermann sonst von »Personen« versteht. Dass an einer Dreifaltigkeitslehre, die fast alle Menschen dahingehend missverstehen, dass es sich doch um drei »Personen« handelt, dass an einer solchen Lehre vielleicht etwas nicht stimmt, dieses Zugeständnis wird man von den Theologen vergeblich erwarten."
Die
Trinitätslehre – "religiöse Lyrik"?
Der Theologe Heinz-Werner
Kubitza vertritt in seinem erst
kürzlich erschienenen Buch Der
Jesuswahn eine Position, die das Fantasiegebilde Trinität
unzweideutig ad absurdum führt::
"Jesus kannte keine Trinität, erst recht nicht mit ihm selbst als trinitarischer Person. Die Ausbildung der Trinitätslehre ist religiöse Lyrik, erdichtet aus spekulativer Fantasie ebenso wie aus theologischer Notwendigkeit. Die Gottesvorstellung Jesu war dagegen einfach und klar, es war (und ist noch heute) die Vorstellung jedes frommen Juden, der neben Gott keinen Platz für irgendwelche Nebenherrscher kennt, mögen sie noch so dreieinig sein."
Anmerkung
Hervorhebung im
Zitat stammt vom Autor der Site.
Die
Trinität – "Antwort auf Marcion"?
Vor einigen Jahren nahm ich an einem Studientag in der evangelischen
Akademie Arnoldshain teil. Das Thema des Tages lautete
ungefähr "Christliche Trinität und jüdischer
Monotheismus". Ein emeritierter Heidelberger Theologieprofessor war
für den christlichen Part zuständig. Er vertrat u. a.
die These, dass die "Trinität eine Antwort auf Marcion"
gewesen sei. Marcion oder Markion
(um 85-160), ein Prominenter unter den ersten "Ketzern" der
Christenheit, hatte, sicher zum Verdruss der auf Wachstum bedachten
jungen Kirche, Mitte des 2. Jahrhunderts die "marcionitische" Kirche
gegründet – ein Konkurrenzunternehmen. Ein wichtiger
Teilaspekt seiner ebenso eigenen Theologie war ein
Gottesverständnis, das Ähnlichkeiten mit dem der Gnosis
aufwies.
Im Gottesverständnis bzw. in den Glaubensfantasien Marcions gab es zwei Gottheiten: einen "bösen Gott" und einen "guten Gott". Der böse Gott war für ihn der im Alten Testament beschriebene Schöpfer-Gott oder Gott des Gesetzes, auch als Demiurg bezeichnet. Demgegenüber galt ihm als guter Gott der von Jesus verkündete und im Neuen Testament beschriebene «Gott der Liebe». Es handelte sich dabei nicht um eine "Binität", wie man annehmen könnte, mit einem entsprechenden wohl definierten Innenleben: Es gab zwischen den beiden Gottheiten keinerlei Beziehung. Sie kannten sich nicht. Das ergab sich auch schon daraus, dass Marcion das AT nicht anerkannte und daher keine Wechselbeziehung bzw. Kontinuität zwischen dem AT und dem NT konstruieren musste.
Der freundliche ältere Theologieprofessor trug seine These mit größter Selbstverständlichkeit vor. Es war nicht zu erkennen, ob er sich der Tragweite seiner Äußerung bewusst war: Die Trinität war also nicht etwa göttlicher Offenbarung zu verdanken, wie es später die führenden Köpfe der "Räubersynoden" des 4. und 5. Jahrhunderts glauben machen wollten, sondern das Ergebnis einer nüchtern kalkulierten Reaktion auf eine konkurrierende Glaubensmeinung. Die "Antwort auf Marcion" war also ein typisches Produkt des religiösen Marktes der Spätantike. Der freundliche ältere Herr machte dennoch nicht den Eindruck, als käme er je auf die Idee, nach der Relevanz dieses Produktes für den religiösen Markt des 21. Jahrhunderts zu fragen oder es gar grundsätzlich in Frage zu stellen.
Dogmen
– unbezweifelbare Wahrheiten?
Bei einigen Theologen fand ich Gedanken, die mir halfen, die
christlichen Dogmen als das zu sehen, was sie schon von allem Anfang an
waren, als Produkte menschlicher Fantasie, deren "Haltbarkeit",
aufgrund ihrer zeitbedingten Ausprägung,
naturgemäß nur von begrenzter Dauer sein konnte. Aus
heutiger Sicht ist ihr "Haltbarkeitsdatum" seit langem abgelaufen.
Der Theologe Klaus-Peter Jörns (*1939) zeigt in seinem Buch Notwendige Abschiede – Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum ganz nüchtern und klar, dass Dogmen allenfalls relative, zeitbedingte "Wahrheiten" transportieren:
"Dogmen werden von Offenbarungsreligionen mit dem Anspruch tradiert, absolute, in sich geschlossene und daher unbezweifelbare Wahrheit zu sein. Sie verbreiten den Anspruch, die ganze Wahrheit oder zumindest die für Menschen erreichbare Wahrheit ganz zu kennen. Die Einsicht, dass Dogmen zeitbedingte Antworten auf zeitbedingte Fragen gegeben haben und daher notwendig vorläufige Aussagen sind, passt in dieses Konzept nicht. Denn es akzeptiert ja die geschichtlichen Bedingungen unserer Wahrnehmung nicht."
In seinem Buch Abschied vom Christentum – Ein Nichtchrist befragt die Religionswissenschaft beschreibt der Theologe und Pädagoge Gustav Wyneken (1875-1964) einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem problematischen Verständnis des Menschen von seiner Religion und den daraus erwachsenen Dogmen:
"Der tiefe Widerwille, der auch schon das bloße Wort Dogma in uns erweckt, ist also nur allzu berechtigt. […] Man muss sich gegenwärtig halten, was Religion überhaupt ist, nämlich dass sie sich nicht abspielt auf der Ebene der Realität, sondern in einem Reich der Phantasie, dass sie das große Spiel ist, dass das Leben der Menschheit begleitet, eine »geistgeschaffene Gegenwelt«, mit der der Mensch seine empirische Welt überwölbt hat. Wir wissen freilich, dass der Mensch nie imstande gewesen ist, seine beiden Welten, die erfahrungsmäßige, ihm gegebene, und die selbst geschaffene seines Gedankenspiels, scharf und sauber auseinander zu halten. Das große Spiel Religion versucht immer wieder in die Erfahrungswelt einzudringen und sich mit ihr zu vermischen. Und was seiner Idee nach nur in der Sphäre des Spiels, sozusagen als Spiel-Annahme und Spiel-Regel, Geltung hat, wird immer wieder missverstanden als Erfahrungswahrheit neben anderen Erfahrungsdaten. Das ist eben der Sündenfall des Dogmas, der dann furchtbare Folgen nach sich gezogen hat, sowohl für den menschlichen Intellekt wie für die menschliche Praxis."
Der ehemalige katholische Priester Peter de Rosa (*1932) bezieht sich in seinem Buch Der Jesus-Mythos – Über die Krise des christlichen Glaubens exemplarisch auf das erste Konzil von Nicäa (325), auf dem zum allerersten Mal ein Dogma beschlossen und zur verbindlichen "Glaubenswahrheit" erklärt wurde, und stellt fest:
"In der griechischen Welt, die wir geerbt haben, sind Dogmen nicht in erster Linie religiös; sie sind der Überbau eines geistigen Imperialismus. Ihr Hauptzweck ist nicht Wahrheit, sondern Ordnung, Weltordnung. Sie zielen darauf ab, Neuerungen zu ersticken, alle Traditionen außer einer zum Schweigen zu bringen, auch die verschiedenen Traditionen, die es vor Nizäa im Neuen Testament und auch in der Urkirche gab. Bezeichnenderweise endete Nizäa mit dem Verbrennen abweichlerischer Bücher. Von nun an wurde das Christentum von dem grausigen Gespenst der Häresie heimgesucht. Dogmen gelten zwar allgemein als katholisch, doch in Wahrheit sind sie sektiererisch. Ihre Funktion ist eine einschüchternde: Ordnung schaffen, Optionen einschränken, teilen und abschotten. Den Mächtigen ist wichtig, dass Dogmen, gebildet von einer göttlichen Institution, als endgültig akzeptiert werden – nicht, dass sie verstanden werden."
Das
Zeitalter der Dogmenbildung – beherrscht vom "Geist der
Lüge"
Bei Martin Werner (1887-1964) fand ich
eine aufschlussreiche Bemerkung, in der er sich auf eine Feststellung
des bedeutenden protestantischen Theologen und Kirchenhistorikers Adolf von Harnack (1851-1930)
bezieht:
"Je entschiedener der religiöse Materialismus des neuen Erlösungsbedürfnisses (im Sinne des Begriffs der »physischen« Erlösung) in Missachtung tieferer Sinnfragen der menschlichen Existenz das Denken bestimmt, desto mehr verliert dieses theologisch-kirchliche Denken in der Behandlung seiner vielfach ohnehin falsch gestellten dogmatischen Fragen die Orientierung an der Idee der Wahrhaftigkeit. Davon zeugt ganz allgemein die Art und Weise, wie man »schriftgemäße« Theologie zu treiben vorgibt. Mit Recht ist in der neueren Dogmengeschichtsschreibung gerade im Hinblick auf das Zeitalter der folgenreichsten altkirchlichen Dogmenbildung aufmerksam gemacht worden auf den »Geist der Lüge, welcher im 4. Jahrhundert schon mächtig in der offiziellen Schriftstellerei sich regte … und in dem 5. und 6. Jahrhundert die Kirche beherrscht hat. In diesen Jahrhunderten hat keiner mehr irgendeiner schriftlichen Urkunde, einem Aktenstück oder Protokoll getraut. Die Briefe der Bischöfe dieser Zeit wimmeln von Anklagen auf Fälschungen«."
In der geistigen Atmosphäre des damaligen Christentums triumphierten offenbar Lüge und Intrige über intellektuelle Redlichkeit und Wahrhaftigkeit. Diese elementaren individual-ethischen Grundlagen menschlicher Gemeinschaft waren weitgehend außer Kraft gesetzt.
Dogmen –
Instrumentalisierte Glaubensmeinungen
Schon ein flüchtiger Blick auf die
Dogmenentstehung vermittelt die Erkenntnis, dass es den
führenden Köpfen des frühen organisierten
Christentums nicht primär darum ging, eine lebensdienliche
Glaubenslehre zu erarbeiten, noch darum, ethische Verhaltensnormen
weiterzuentwickeln. Die in den vorausgehenden Kapiteln beschriebenen
Einzelheiten über die entscheidenden Konzilien lassen vielmehr
den Schluss zu, dass es in den z. T. brutalen Auseinandersetzungen
über unterschiedliche Glaubensmeinungen vornehmlich um den
Ausbau von Macht und Vorherrschaft ging.
Beispielhaft sei hier an zwei maßgeblich beteiligte skrupellose Machtmenschen des 4. und 5. Jahrhunderts erinnert, die beide als Gewaltverbrecher in die Geschichte eingegangen sind: Der römische Kaiser Konstantin und Kyrill, Patriarch von Alexandria.
Kaiser Konstantin (um 272/85-337), von dem Voltaire (1694-1778) sagte, er sei "ein politisch nicht unbegabter Krimineller" gewesen, hatte auf dem ersten Konzil von Nicäa (325) die Fäden gezogen und schreckte ein Jahr später nicht davor zurück, seinen Sohn Crispus aus erster Ehe und seine Frau Fausta sowie weitere Verwandte ermorden zu lassen. Damit wird nur ein winziger Ausschnitt aus seiner Karriere als "Krimineller" beleuchtet. – Dass die römische und die orthodoxe Konfession Konstantin, "der ungetauft bis knapp vor seinem Lebensende als Herrscher mit dem Heidentum nie wirklich gebrochen hat" (Martin Werner), als frühes Glied ihrer Kirchen sehen, erscheint mir als sehr gewagt: Für die orthodoxe Konfession ist Konstantin bis heute ein "Heiliger". Die römische Konfession hat sich merkwürdigerweise nicht dazu durchringen können ihn heilig zu sprechen, "dennoch wird ihm im Namenstagskalender gedacht" (s. hier). Verhindert wurde seine "förmliche Anerkennung als Heiliger durch die katholische Kirche" nicht etwa durch die ihm zur Last gelegten, abscheulichen Verbrechen, sondern durch die Tatsache, dass er kurz vor seinem Tod von Eusebius von Nikomedia (†341), einem Anhänger des Arianismus, getauft worden war, was ihn zum "Ketzer" machte.
Anmerkung
Auch ohne Konstantin ließe sich aus der Liste der "Heiligen"
der römischen Konfession problemlos eine umfangreiche
"Verbrecherkartei" erstellen. Ein aussichtsreicher Kandidat
für diese Kartei wäre ganz sicher Kyrill von
Alexandria (s. u.).
Kyrill (um 375/80-444), Patriarch von Alexandria, ordnete im 5. Jahrhundert u. a. die erste "Endlösung" an, der mehr als hunderttausend Juden zum Opfer fielen (Karlheinz Deschner), und er war mutmaßlich für die grauenvolle Ermordung der Philosophin Hypatia (370-415) verantwortlich. Kyrill beherrschte das Konzil von Ephesos (431) und das entsprechende Geschehen danach bis zu seinem Tod im Jahr 444. – Er wird von mehreren Konfessionen als Heiliger verehrt. Die römische Konfession ging noch weiter: Papst Leo XIII. ernannte ihn 1882 zum Kirchenlehrer (s. hier).
Die konkurrierenden Glaubensmeinungen – allesamt Fantasieprodukte theologischen Denkens spätantik-hellenistischer Prägung – waren nützliche Vehikel im Machtkampf zwischen den kirchlichen Zentren bzw. theologischen Schulen in Alexandria, Antiochia, Konstantinopel und Rom. Anders sind die zweifelhaften Begleitumstände beim Zustandekommen der Beschlüsse – die jeweiligen Kontrahenten arbeiteten mit Intrigen, Erpressung, Bestechung, Verbannung, Gewalttätigkeiten etc. – nicht zu erklären. Es kam nicht von ungefähr, dass Carl Amery (1922-2005) die entscheidenden Konzilien "die Räubersynoden jener Jahrzehnte" nannte, denn sie unterschieden sich im Ablauf wohl alle nicht wesentlich von der mit dem Prädikat "Räuberversammlung" ausgezeichneten Synode von Ephesos im Jahre 449.
Anmerkung
Sonderlich viel hat sich seit jenen Tagen offenbar
nicht geändert. Diese Erkenntnis drängt sich auf,
wenn man erfährt, dass es selbst heute in Teilen der
christlichen Kirchen und ihrer theologischen Fakultäten
Verhaltensweisen gibt, die den Theologen Friedrich Wilhelm Graf (*1948)
erst kürzlich dazu nötigten, sie als
"kirchenpolitischen Stellungskrieg und klerikalen Dschungelkampf" zu
beschreiben (s. hier).
Dogmen
– Rechtsgrundlage für die Verfolgung von
Häretikern
Die beschlossenen Dogmen bildeten den
Maßstab, an dem jede abweichende Glaubensmeinung gemessen
werden konnte, sie bekamen gewissermaßen den Status einer
"Rechtsgrundlage" für das kirchliche Vorgehen gegen alle
tatsächlichen oder vermeintlichen Häretiker.
Die sog. Verdammungsklausel am Ende des Nicänums ist
hierfür ein überzeugender Beleg (Zitat aus
Wikipedia):
"Diejenigen aber, die da sagen »es gab eine Zeit, da er nicht war« und »er war nicht, bevor er gezeugt wurde«, und er sei aus dem Nichtseienden geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die verdammt die katholische Kirche. [richtig: die belegt die katholische Kirche mit dem Anathema]."
Die Dogmen ließen sich umso leichter als Rechtsgrundlage benutzen, als die jeweiligen Machthaber das Kirchenvolk glauben machten, die geltenden Dogmen seien durch eine "göttliche" Institution beschlossen worden. Gottfried Arnold (1666-1714) kritisierte diese plumpe Irreführung schon im Zusammenhang mit den Beschlüssen des ersten Konzils von Nicäa (325) mit den Worten:
"… als wenn Gott selber alles getan und geredet hätte, was das Konzil abfasste, wie die Autoren sich nicht scheuen zu bekennen."
Anmerkung
Die
auf den Konzilien von Nicäa
(325) und Konstantinopel (381) beschlossenen
Glaubensbekenntnisse, das Nicänum und das Nicäno-Konstantinopolitanum,
haben in der kirchlichen bzw. gottesdienstlichen Praxis wohl lange Zeit
kaum eine Rolle gespielt. Diese Annahme lässt sich
insbesondere aus der Tatsache ableiten, dass diese Bekenntnisse
frühestens durch die Protokolle des Konzils von Chalcedon (451) bezeugt werden.
Die in Chalcedon beschlossenen Ergänzungen (das Chalcedonense) sind wohl ohnehin
nur von Theologen für Theologen verfasste Formeln. Bernd Moeller bezeichnet
sie als "merkwürdig unanschaulich und formalistisch".
Im protestantischen Bereich ist das Apostolische Glaubensbekenntnis
gebräuchlich, das auf eine ältere Tradition der
frühen Kirche zurückgeht. Seit 1970 gibt es eine ökumenische
Fassung von der "Arbeitsgemeinschaft für liturgische
Texte der Kirchen des deutschen Sprachgebietes".
Differenzierung
kontra Uniformierung
Der Altphilologe Wilhelm Nestle (1865-1959) stellt
in der Einleitung zu seinem 1947 erschienenen grundlegenden Werk Die Krisis des Christentums
fest: "Überall, wo Leben ist, physisches oder geistiges, ist
Differenzierung ..." Und er fährt fort mit einem Blick auf ihr
Gegenteil, die Uniformierung: Diese sei "gerade
im geistigen Leben bedenklich und gefährlich, weil sie das
individuelle Wachstum der Persönlichkeit unterbindet und so
Möglichkeiten der Entwicklung abschneidet, die sich daraus
ergeben können." Damit spricht er m. E., ohne es explizit zu
formulieren, die unausweichliche, negative Wirkung von Dogmen an.
Er betont darüber hinaus die Einhaltung notwendiger Verhaltensregeln im Umgang mit den Ergebnissen der Differenzierung, wie wir sie auch und gerade im Bereich des Christentums vorfinden: "Nur muss bei der Differenzierung der Auffassungen die Freiheit der geistigen Auseinandersetzung gewahrt werden und darf es nicht dahin kommen, dass die verschiedenen Richtungen sich gegenseitig verketzern und die Achtung versagen."
Ich denke, die von Nestle angemahnten Verhaltensregeln fanden, wie weiter oben deutlich wurde, im Verlaufe der Geschichte des organisierten Christentums kaum jemals die nötige Beachtung.
Dogma
oder Dogmatiker im heutigen Sprachgebrauch
Die Begriffe Dogma oder Dogmatiker
sind im heutigen Sprachgebrauch m. E. überwiegend negativ
besetzt. Die mitgedachte negative Bedeutung leitet sich für
viele Menschen zweifelsohne aus den historisch belegten Fehlleistungen
des Christentums ab. Für andere Zeitgenossen, bei denen diese
Erfahrungen fehlen, weil sie keine oder nur noch eine lose Beziehung
zum Christentum haben, ist das entsprechende Sprachempfinden wohl eher
durch die analogen Erfahrungen mit den historisch viel
jüngeren, rechts- oder linksgerichteten,
gewalttätigen Ideologien geprägt. Letztere
verhielten und verhalten sich, bei der Durchsetzung ihrer dogmatisch
geprägten Weltanschauungen, ganz ähnlich, wie es das
organisierte Christentum nahezu 2000 Jahre lang tat.
Wer jemand einen Dogmatiker nennt, vermeidet damit wohl, ihn als "Betonkopf" zu bezeichnen, mit jenem Sinnbild, das für Sturheit, für mangelnde geistige Offenheit sowie für Selbstgerechtigkeit und Intoleranz steht.
![]()
Schlussbemerkungen
Schon die hier versuchte, eher bruchstückhafte, Beschreibung und kritische Würdigung der Dogmenentwicklung fördert die Gewissheit, dass die von den diversen christlichen Konfessionen noch heute, etwa 16hundert Jahre nach ihrer Festlegung, aufrechterhaltenen Dogmen für keinen halbwegs aufgeklärten Menschen von irgendeiner Relevanz sein können.
Auf den entscheidenden, jeweils von wenigen Machtmenschen dominierten, Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts, auf jenen Zusammenkünften »gut oder schlecht informierter Männer« (Peter de Rosa), wurden Glaubensmeinungen in Dogmen gegossen, die die maßgeblichen kirchlichen und/oder weltlichen Machthaber, aus leicht zu durchschauenden Motiven, alsbald in den Rang "göttlicher Wahrheiten" erhoben. Dass diese historische Tatsache die Theologen, von seltenen Ausnahmen abgesehen, selbst heute immer noch nicht veranlasst, kritische Fragen zu stellen und von ihren Kirchenoberen ein Umdenken zu fordern, ist m. E. ein unentschuldbares Fehlverhalten – kurz: ein Skandal!
Daher finde ich überzeugend und ermutigend zugleich, was der slowakische evangelische Theologe Karol Nandrásky (1927-2016) in einem Beitrag unter dem Titel Der sich häutende Gott in Publik-Forum 8 · 2008 einleitend bekennt:
"Schon seit langem ist mir klar, dass wir heraussteigen müssen aus der Rumpelkammer des kirchlichen Dogmatismus. Wir müssen hineinfinden in den konkreten und mühseligen Weg der Evolution des Weltalls, zu dem die Naturforscher die Landkarte zeichneten."
zurück zu Historisches
