











 |
 |
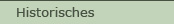 |
 |
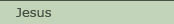 |
 |
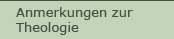 |
 |
|
Der Reformator Vom Übersinnlichen ist, was das spekulative Vermögen der Vernunft betrifft, keine Erkenntnis möglich. Der Philosoph Zweifel sind nur dem quälend,
der glaubt, nie dem, welcher bloß der eigenen Untersuchung
folgt. Der
Gelehrte und
Staatsmann
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) Gewiss, wir wissen zu viel, zu viel insbesondere von Dingen, von denen wir nichts wissen können. Der Theologe Gott ist eine vom Menschen erdachte Hypothese bei dem Versuch, mit dem Problem der Existenz fertigzuwerden. Der englische Biologe und Philosoph Gott ist die aufs Lächerlichste vermenschlichte Erfindung der ganzen Menschheit. In den Jahrmilliarden, die unsere Erde alt ist, sollte sich Gott erst vor 4000 Jahren den Juden und vor knapp 2000 Jahren den Christen offenbart haben, mit deutlicher Bevorzugung der weißen Rasse unter Vernachlässigung der Schwarzen, der Gelben und der Rothäute? Auf solche Märchen kann ich mühelos verzichten. Die deutsch-frz.
Schriftstellerin «Gott» ist für mich eine der vielen poetischen Ausdrucksweisen für den höchsten Wert im Humanismus und keine Realität an sich. Der dt.-amerik.
Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Seit er meinen Bruder kreuzigen ließ, um sich mit mir zu versöhnen, weiß ich, was ich von meinem Vater zu halten habe. Der Schriftsteller Unter Skeptikern verstehe ich nicht Leute, die an der Existenz Gottes zweifeln, sondern Zweifler, die an der Verstandesfeindlichkeit der christlichen Kirchen verzweifeln. Die kath. Theologin |
||
Gottesverständnis
![]()
Inhalt
- Vorbemerkungen
- Das komplizierte Innenleben des trinitarischen Gottes
- Theodizee – «Gott» und die Übel der Welt
- Wichtige Gedanken über das, was wir «Gott» nennen aus den letzten 2500 Jahren
- Schlussbemerkungen
![]()
Vorbemerkungen
Es gab Zeiten, in denen ich von den Menschen, die über «Gott» sprachen, das von ihnen gezeichnete Gottesbild unreflektiert übernahm. Ich glaubte ihnen, wenn sie auf die zahlreichen Wundertaten «Gottes» hinwiesen, auf die, von denen die Bibel berichtete, aber auch auf jene, die – bei aufmerksamer Betrachtung – im Leben jedes Einzelnen vorkämen. Ich glaubte zu wissen, wer «Gott» ist.
Zuerst war da der "liebe «Gott»" der Kinderzeit. Dann gewann zeitweise das Bild des "göttlichen Bruders" Jesus Christus, eine der drei "Personen" des "dreieinigen Gottes", an Bedeutung. Ich traf Menschen, die dieses Bild denjenigen empfahlen, die ein Problem mit dem zornigen, richtenden "Gott-Vater" hatten. Letzterer spielte, nach meiner Erinnerung, insbesondere in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges, Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, eine Furcht erregende Rolle. Ich erinnere mich an Menschen, die damals sog. "Zeichen der Zeit" zu erkennen glaubten, die nach ihrer Auffassung das baldige Kommen des in der Bibel angedrohten Weltendes mit dem Jüngsten Gericht ankündigten.
Später glaubte ich am besten mit dem Bild einer, nicht näher beschreibbaren, im gesamten Universum wirksamen «Kraft» leben zu können. Hatte ich mich damit dem Gottesverständnis der Mystiker, dem der Pantheisten oder Panentheisten, angenähert? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich mich damit ganz sicher vom (mono)theistischen Gottesbild des Christentums – in seiner trinitarischen Ausprägung – verabschiedet.
Heute, am 27. Juli 2008, während ich diese Zeilen niederschreibe, weiß ich nicht, wer oder was «Gott» ist. Ebenso wenig weiß ich, ob er existiert oder nicht.
Mir erscheint daher eine Empfehlung des mittelalterlichen Mystikers Meister Eckehart (1260-1328) als sehr beherzigenswert, die er in seiner 42. Predigt gab:
"Schweig daher und klaffe nicht über Gott, denn damit, dass Du über ihn klaffst, lügst du, tust du Sünde. Willst du nun aber ohne Sünde und vollkommen sein, so klaffe nicht über Gott! Auch erkennen (wollen) sollst du nichts von Gott, denn Gott ist über allem Erkennen. Ein Meister sagt: Hätte ich einen Gott, den ich erkennen könnte, ich würde ihn nimmer für Gott ansehen!"
Dennoch möchte ich nicht ganz darauf verzichten, im Folgenden ein paar eigene Gedanken zum Thema zu äußern, aber vor allem andere Menschen zu Wort kommen zu lassen, die m. E. über das was wir «Gott» nennen Wichtiges zu sagen haben. Der Abschnitt Wichtige Gedanken über das, was wir «Gott» nennen aus den letzten 2500 Jahren enthält eine kurze, vorläufige und ganz subjektive Auswahl entsprechender Äußerungen zum Gottesverständnis.
Anmerkungen
- Das von Meister Eckehart gebrauchte
altertümliche Wort klaffen, was unserem kläffen
entspricht, würde man heute wohl durch schwatzen
ersetzen.
- Mir ist bewusst, dass so, wie Meister Eckehart dies tut, eigentlich
nur jemand sprechen kann, der die Existenz eines «Gottes»,
welcher Ausprägung auch immer, voraussetzt.
![]()
Das
komplizierte Innenleben des trinitarischen Gottes
Auf der Seite Dogmen und andere Glaubensmeinungen habe ich versucht, den historischen Prozess der Entstehung und Festlegung der wesentlichen christlichen Dogmen, zumindest skizzenhaft, zu beschreiben. Die Festlegung der «Trinität» – als verbindliches Gottesverständnis – war eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Prozesses.
Im Folgenden versuche ich die dogmatisch fixierte christliche Vorstellung vom «dreieinigen Gott» (protestantisch) bzw. vom «dreifaltigen Gott» (römisch) bildlich darzustellen:
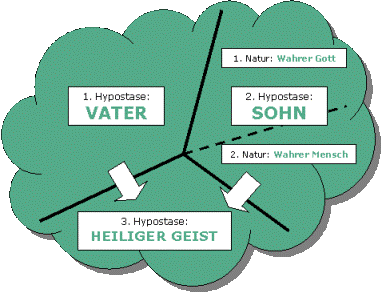
Die Abbildung spiegelt die
Ergebnisse
- des 1. Konzils von Nicäa
(325), auf dem die Gottheit des
«Sohnes» (Jesus Christus) beschlossen
wurde,
- des 1. Konzils von Konstantinopel
(381), das die Gottheit des
«Heiligen Geistes» und die «Trinität»
verkündete,
- des Konzils von Chalcedon
(451), auf dem festgelegt wurde, dass der Gottessohn bzw. der Gott
Christus eine einzige Person bzw. Hypostase sei, die zwei Naturen
besitze, eine göttliche und eine menschliche, "die jedoch
weder miteinander vermischt oder ineinander verwandelt noch geschieden
oder getrennt sein sollten" (Bernd
Moeller).
- des 3. Konzils von Toledo (589), das das Glaubensbekenntnis von
Konstantinopel (381) um das filioque
ergänzte: »Wir glauben an den Heiligen Geist, der
Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater
und dem Sohn
hervorgeht.«
In der bildlichen Darstellung wird noch deutlicher, wie fantasievoll
die Chefdogmatiker des frühen Christentums auf den
"Räubersynoden" des 4. und 5. Jahrhunderts und,
abschließend, im 6. Jahrhundert in Toledo das "Innenleben"
ihres «Gottes» strukturierten. Diese
Spitzenkleriker dachten und fantasierten nicht sehr viel anders als die
Menschen des alten Griechenlands, die ihren Göttern auf dem Olymp
sehr spezifische Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen
andichteten. Heute betrachten wir diese Vorstellungen allenfalls noch
als historisch oder literarisch interessante Aspekte der
althergebrachten Mythologie einer längst untergegangenen
Kultur: Kein Mensch betet heute mehr die griechischen Götter Aphrodite,
Dionysos, Poseidon
oder Zeus an, ebenso wenig wie die
römischen Gottheiten der Kapitolinischen Trias: Jupiter, Juno und Minerva.
Die religiösen Vorstellungen des Christentums basieren primär auf der jüdischen bzw. vorderasiatischen Mythologie: Nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in ihrer neuen Heimat wohl mit einem lokalen Berggott in Berührung, den sie in der Folgezeit zu ihrem exklusiven Gott JHWH weiterentwickelten. In der Spätantike wurden diese Vorstellungen angereichert um den Jesus-Mythos einer kleinen jüdischen Sekte, der dann, unter dem Einfluss hellenistischen Denkens, zum Christus-Mythos mutierte. Die religiösen Vorstellungen des Christentums sind also ebenfalls nichts anderes als Mythologie. Heute, so scheint es, ist eine der Hauptaufgaben der Vertreter des organisierten Christentums zu verschleiern, dass es sich um Mythologie handelt.
Christlicher
Monotheismus – Tritheismus oder Polytheismus?
Den Beteuerungen christlicher Theologen zum Trotz,
dass die von ihnen vertretene trinitarische Gottesvorstellung nur
symbolischen Charakter habe, dass sie keine Abkehr vom
ursprünglichen Monotheismus bedeute, ist
für Außenstehende, z. B. für Menschen aus
der islamischen Welt, nicht überzeugend. Es verwundert daher
nicht, dass letztere dem Christentum "Tritheismus"
oder "Polytheismus"
vorhalten. Kürzlich erzählte mir ein Bekannter, ein
Angehöriger einer islamischen Glaubensgemeinschaft habe ihm
gegenüber die Meinung geäußert, dass die
Christen "drei Götter" anbeteten: Gott-Vater,
Christus und Maria. Augenscheinlich war das Bewusstsein des
islamischen Gesprächspartners von seiner Wahrnehmung der
Praxis der römischen Konfession geprägt.
Die hier zitierte Einzelmeinung eines Islam-Gläubigen betrachte ich nicht als repräsentativ, aber auch nicht als ungewöhnlich. Bietet doch das Christentum, in seinen verschiedenen Konfessionen und sektiererischen Strömungen, für Außenstehende kein klares Bild. Missverständnisse sind vorprogrammiert. Letzteres gilt ganz besonders im Zusammenhang mit der weit verbreiteten christlichen "Trinität". Die Ausprägung der inneren Grundstruktur des christlichen Gottes, die Dreiheit, ist noch nicht einmal eine christliche Erfindung. Es gab sie analog in der Ideenwelt verschiedener älterer Religionen bzw. Mysterienkulte, die heute nicht mehr existieren (s. hier). Offenkundig haben bei den Vordenkern der frühen Kirche auch taktische Überlegungen eine Rolle gespielt: Die Verwendung von bekannten, im Bewusstsein der antiken Zeitgenossen verankerten, Bildern verbesserte die Chancen des frühen Christentums im Wettbewerb mit den älteren antiken Kulten.
Die Mär von der symbolischen
oder metaphorischen Rede
Manche Theologen sind der Auffassung, man
könne von Gott nur symbolisch oder metaphorisch
reden. Im Gegensatz dazu empfehlen andere ihren "Gläubigen" an
einen persönlichen Gott, an dessen »personale
Wirklichkeit«, zu glauben. Wahrscheinlich spiegelt das ihre
eigene Glaubensmeinung bzw. ihr individuelles Gottesbild wider.
Tatsache ist, dass es sowohl den Theologen als auch, und vor allem, den
Gläubigen kaum gelingt symbolisch zu
denken und zu reden.
Die zugrunde liegende Problematik wird m. E. verschärft durch die dogmatisch fixierte Dreieinigkeit des christlichen Gottes: Ist es verwunderlich, wenn im Bewusstsein der "Gläubigen" parallel zum (vermeintlich) symbolisch gedachten Gottes-Sohn Christus der Mensch Jesus bzw. der göttliche »Bruder« auftauchen? Ebenso schwer fällt der Versuch, symbolisch vom Gott-Vater zu reden, ohne gleichzeitig etwa an die Darstellung des Schöpfers in Michelangelos (1475-1564) berühmtem Deckengemälde "Die Erschaffung Adams", in der Sixtinischen Kapelle des Petersdoms in Rom, zu denken. Die Liste möglicher Assoziationen ließe sich fortsetzen.
Im Folgenden kommen zwei Insider zu Wort, die das zwiespältige Denken und Reden in den Theologien des organisierten Christentums kritisch beleuchten.
Der britische Autor und ehemalige katholische Priester Peter de Rosa (*1932) beschreibt u. a. das real existierende Dilemma der Theologie in seinem Buch der Jesus-Mythos. Hier ein kurzer Ausschnitt daraus:
"Thomas von Aquin sah […] in seinen besten Momenten, dass nichts Verstehbares über Gott ausgesagt werden kann. Und selbst der nackteste metaphysische Gottesbegriff der Theologen – ein höchstes Seiendes, ein geistiges Wesen über allen Wesen, dass aus dem Nichts erschafft –, auch er ist mythologisch. Weil sie dies nicht sehen, sind ihr Denken und ihr Reden über Gott irreführend. Der Gottheit irgendein Attribut buchstäblich zuzuweisen, macht sie ärmer. Selbst zu sagen, er sei ein Schöpfer, und nicht zu begreifen, dass dies Mythologie ist, reduziert Gott. […]
Die offizielle, hierarchische Religion neigt außerdem dazu, Gott zu zähmen und zu bürokratisieren. Obwohl Dogmatiker und Moraltheologen als erstes anerkennen, dass Gott unerkennbar ist, gehen sie dann recht bald dazu über, anmaßend und ohne Einschränkung zu sagen, wie Gott ist, sogar sein inneres Leben als Einheit dreier Personen zu beschreiben – und was er in jeder Lage vom Menschen fordert. Sie geben ihre vorgegebene Demut rasch auf. Dies ist bloße Tyrannei in anderer, schlimmerer Form: eine geistige Tyrannei, die vielerorts ohne Einschränkung mit Religion identifiziert wird."
Anmerkung
Hervorhebung
im Zitat stammt vom Autor der Site.
Der emeritierte Theologe Matthias Kroeger (*1935) befasst sich mit der bei vielen TheologInnen unterentwickelten Disziplin im Denken und Reden in seinem Buch Im religiösen Umbruch der Welt: Der fällige Ruck in den Köpfen der Kirche:
"In der Regel lautet die Verfahrenslogik so: Zwar könne man von Gott nur symbolisch oder metaphorisch sprechen, da wir ihn aber aus den Schöpfungswerken und letztlich in Jesus Christus kennen, dürfen wir »die Worte, Begriffe, Bilder, mit denen wir Geschöpfliches bezeichnen, trotz ihrer Unangemessenheit auf Gott anwenden« (W. Härle). […] Alsdann aber wird das Bewusstsein der Uneigentlichkeit und der nur symbolisch legitime Rang theistischer Rede konsequent vernachlässigt, ja übergangen; es wird geredet wie vorher. Die an sich vorhandene Einsicht nur symbolisch/metaphorisch möglicher Rede und einer direkt und wörtlich nicht möglichen Bezeichnung des Göttlichen bleibt theoretischer Schlenker – ohne Konsequenz und Vorbehalt im weiterhin ungeniert theistischen Gebrauch der Worte."
Fazit
Wenn zutrifft, was Thomas von Aquin (um 1225-1274)
und andere Theologen und Philosophen ausgedrückt haben, dass
über das was wir Gott nennen keine
konkreten Aussagen möglich sind, und ich zweifele nicht daran,
dann ist das grundlegende, im Alten Testament beschriebene,
Verständnis vom Vatergott obsolet. Und was für dieses
uralte Bild zutrifft, gilt erst recht für die vom Christentum
viel später hineingemalten trinitarischen Arabesken: Die
Trinität ist für mich überhaupt
keine relevante Denkfigur mehr.
Ich frage mich, wann sich diese Erkenntnis auch in den Köpfen des organisierten Christentums durchsetzt, und die für den christlichen Ritus daraus folgenden logischen Konsequenzen gezogen werden. Diese naive rhetorische Frage ist leicht zu beantworten: sehr wahrscheinlich nie! Das organisierte Christentum würde damit "Harakiri" begehen, und das ist nicht zu erwarten. Wahrscheinlicher ist, dass es irgendwann, wie andere Religionen vor ihm, aufgrund geistiger und personeller Auszehrung, aus der Geschichte verschwinden wird und mit ihm der von ihm erfundene «Gott».
![]()
Theodizee
– «Gott» und die Übel der Welt
Der Begriff Theodizee wurde vom Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) geprägt. Er setzt sich zusammen aus den griechischen Worten für Gott (theos) und für Gerechtigkeit (dike) und heißt übersetzt "Rechtfertigung Gottes". Anders ausgedrückt geht es etwa um die Frage: Wie lassen sich die Gott zugeschriebenen Eigenschaften Allmacht, (All)Güte, Gerechtigkeit etc. angesichts der zahlreichen Leiden in der Welt begründen bzw. rechtfertigen? Letztlich geht es um die Frage ob das, was wir «Gott» nennen, existiert oder nicht.
Dem "Problem des Elends in der Welt" sind führende Denker verschiedener Kulturen schon seit dem Altertum, also lange vor Leibniz und anderen Denkern der Neuzeit, nachgegangen. Eine bekannte, dem griechischen Philosophen Epikur (341-ca. 270 v. Chr.) zugeschriebene Argumentation liest sich so:
"Entweder will Gott das Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es nicht, oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig wie schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel, und warum nimmt er sie nicht weg?"
Die Auseinandersetzung über die sog. Theodizee führt, über die kritischen Fragen nach der Liebe, der Güte oder der Gerechtigkeit Gottes, zwangsläufig zu der weitergehenden Frage nach seiner Existenz. Während Theologen die Frage trotz allem bejahen, ziehen religionskritische Denker die Existenz Gottes in Zweifel oder verneinen sie. Schon aus der Epikur zugeschriebenen Auffassung lässt sich kaum eine andere als die letztgenannte Position ableiten.
Irgendwo las ich, dass den Theologen eine Gegenfrage einfiel: »Woher kommt das Gute, wenn es Gott nicht gibt?« – Jene findigen Theologen merkten offenbar nicht, dass sie einem klassischen Zirkelschluss aufgesessen waren.
Der "sublime Wahn" des
Universalgelehrten Leibniz
Ich habe mich mit der Leibnizschen Position zur Theodizee
nicht intensiv genug befasst, um sie hier umfassend darstellen zu
können. Mir erscheint jedoch die von ihm vertretene
Auffassung, dass Gott "die beste aller möglichen Welten"
geschaffen habe, als ausgesprochen merkwürdig. Sie bleibt
merkwürdig, auch wenn Leibniz mögliche Kritik an
seiner These durch den Hinweis zu entkräften versuchte, dass
«Gott» – in seiner unendlichen
Güte – eine noch bessere Welt geschaffen
hätte, wenn ihm dies möglich gewesen wäre.
Ich weiß nicht, ob Leibniz Theist
oder eher Deist war, mit seiner sonderbaren
These, mit der er das Theodizee-Problem gelöst zu haben
meinte, reduzierte er die «Gott» zugeschriebene
Fülle Ehrfurcht gebietender Attribute zumindest um Allmacht
und Vollkommenheit. – War dies womöglich seine
Art der Kritik an dem althergebrachten Gottesbild?
In seinem Buch Der Jesus-Mythos diagnostiziert der ehemalige katholische Priester Peter de Rosa (*1932) bei Leibniz einen "sublimen Wahn" und ergänzt sarkastisch:
"Es war nett von ihm, das seinem deutschen Publikum zu offenbaren, das sich bestimmt geehrt fühlte, einen Platz in der einzig möglichen Welt zu haben. Man fragt sich, ob er wohl auch Gott informiert hat."
Auch der große Theologe, Philosoph und Arzt Albert Schweitzer (1875-1965) äußerte sich kritisch über die Leibnizsche Auffassung. In Aus meinem Leben und Denken schreibt er:
"Schon während meiner Gymnasialzeit war mir klar, dass mich keine Erklärung des Übels in der Welt jemals befriedigen könne, sondern dass sie alle auf Sophistereien hinausliefen und im Grunde nichts anderes bezweckten, als es den Menschen zu ermöglichen, das Elend um sie herum weniger lebhaft mitzuerleben. Dass ein Denker wie Leibniz die armselige Auskunft vorbringen konnte, diese Welt sei zwar nicht gut, aber unter den möglichen die beste, ist mir immer unverständlich geblieben."
Schweitzer macht anschließend deutlich, wie er persönlich mit dem "Problem des Elends in der Welt" umgehe:
"Sosehr mich das Problem des Elends in der Welt beschäftigte, so verlor ich mich doch nie in Grübeln darüber, sondern hielt mich an den Gedanken, dass es jedem von uns verliehen sei, etwas von diesem Elend zum Aufhören zu bringen."
Anmerkung
Voltaire
(1694-1778), französischer Philosoph und Autor und einer der
führenden Köpfe der europäischen
Aufklärung, setzte sich mit den Thesen des Universalgelehrten
sehr kritisch auseinander. In seinem Roman Candide oder der Optimismus
– eigentlich eine "philosphische Satire" – entlarvt
er die "Leibnizsche Doktrin des »Alles ist gut«"
als absurdes Hirngespinst.
Positionen von Philosophen und
kritischen Theologen
Schon die eher oberflächliche
Beschäftigung mit der sog. Theodizee
förderte in mir die Überzeugung, dass es für
mich wenig Sinn machte, das Thema zu vertiefen. Für
diejenigen, die dem organisierten Christentum eher distanziert oder
kritisch gegenüber stehen, ist es allenfalls von akademischem
Interesse. Dennoch seien im Folgenden Gedanken von Menschen aus der
jüngeren Vergangenheit zitiert, die sich eingehender mit der
Thematik befasst haben.
Der deutsch-amerikanische Philosoph Walter Kaufmann (1921-1980) macht in seinem Buch Der Glaube eines Ketzers klar, unter welchen Voraussetzungen "das Leiden" in der Welt zum Problem wird:
"Für Atheismus und Polytheismus bedeutet das Leiden kein spezielles Problem, und auch nicht für jede Art von Monotheismus. Zum Problem wird das Leiden dann, wenn der Monotheismus durch zwei Annahmen bereichert – oder verarmt – ist: dass Gott allmächtig und dass er gerecht ist. Ja, der populäre Gottesglaube behauptet nicht nur, Gott sei gerecht, sondern mehr noch: er sei »gut«, sei moralisch vollkommen, hasse das Leiden, liebe den Menschen, sei unendlich barmherzig, überschreite bei Weitem jede menschliche Güte, Liebe und Vollkommenheit. Wenn man diese Voraussetzungen hinnimmt, erhebt sich das Problem: Warum gibt es dann all das Leiden, das wir kennen? Solange diese Voraussetzungen gelten, kann die Frage nicht beantwortet werden. Denn wenn die Voraussetzungen richtig wären, würde daraus folgen, dass es all dieses Leiden nicht geben könnte. Umgekehrt: Da dieses Leiden Tatsache ist, muss offenbar zumindest eine der Voraussetzungen falsch sein. Der populäre Gottesglaube wird durch die Tatsache widerlegt, dass es so viel Leiden gibt. Der von Tausenden gepredigte und von Millionen von Gläubigen akzeptierte Theismus wird durch Auschwitz und eine Milliarde geringerer Übel widerlegt."
In dem 1987 erschienenen Buch Christlicher Glaube und intellektuelles Gewissen des Philosophen und Theologen Helmut Groos (1900-1996) fand ich diese Überlegungen (s. S. 386):
"Die gewaltige Ungleichheit der Begabungen und die Unterschiede in den Anlagen insgesamt sind kennzeichnend für die menschliche Art. Ein ungerechtes Schicksal wird dem Menschen gleichsam schon in die Wiege gelegt, es ist geradezu a priori gegeben. Inwiefern gilt Gott eigentlich als gerecht? Und was insbesondere seine Liebe betrifft, so hat ein alles andere als atheistisch eingestellter Philosoph, Karl Groos, der dem Gottesproblem auf dem Wege einer induktiven Metaphysik beizukommen suchte, überdies ein milder, ganz und gar nicht polemischer Denker, hier die entscheidende Weichenstellung vorgenommen und die Sachlage sehr prägnant formuliert: »Sieht man nur auf die Tatsachen«, stellt er, einige Jahre vor Auschwitz, fest, »so kann man bei dem Anblick der furchtbaren Leiden, denen das Leben ausgesetzt ist, schwerlich auf den Gedanken kommen, dass der Weltenlenker von Liebe zu den Menschen beseelt sei«. So sachlich, kurz und klar ist dieser ebenso einfache wie bedeutungsvolle Sachverhalt kaum je ausgesprochen worden."
Anmerkungen
- Der Philosoph und Psychologe Karl Groos (1861-1946) war Lehrer
von Helmut Groos. Trotz
Namensgleichheit waren sie nicht miteinander verwandt.
In Fortführung seiner Gedanken zeigt Helmut Groos auf, dass sich das Vorhandensein "christlicher Nächstenliebe und humanitärer Güte" unter den Menschen "durch die Evolution hinreichend erklären" lasse – "Dazu wird Gott nicht benötigt" (s. S. 386/387):
"Es ist auch nicht etwa möglich, die Annahme der Liebe Gottes mit der im menschlichen Bereich erfahrbaren Liebe im Sinne der christlichen Nächstenliebe und humanitären Güte in der Weise in Zusammenhang zu bringen, dass diese auf jene, die göttliche Liebe, zurückgeführt wird, denn was an solcher Liebe und Güte in der Menschheit zu finden ist, lässt sich durch die Evolution hinreichend erklären. Dazu wird Gott nicht benötigt. Die Nächstenliebe ist nicht irgendwann und irgendwo einmal vom Himmel gefallen, vielmehr wie die Gerechtigkeit als Norm und Praxis des Verhaltens im Verlaufe der natur- und kulturgeschichtlichen Entwicklung ausgebildet worden, freilich nirgends so besonders und stark ausgeprägt, betont und verwirklicht wie auf dem Boden des Christentums – das soll nicht von ihm genommen werden, sondern ihm ausdrücklich bestätigt und hier hervorgehoben werden. […] Der Gedanke der Liebe Gottes liegt, wenn man die Erfahrung ausschlaggebend sein lässt, alles andere als nahe. Er ist nicht begründbar und schlechthin nicht zu halten."
Anmerkungen
- Helmut Groos
bezieht sich in seiner Argumentation sowohl auf die Evolution
als auch auf die soziokulturelle
Evolution.
- Hervorhebung im
vorausgehenden Zitat stammt vom Autor der Site.
Der österreichische Philosoph Gerhard Streminger (*1952) beleuchtet im Anhang seines 2008 erschienenen Buches Ecce Terra, unter dem Titel Abschied vom Theozentrismus, auch die Theodizee-Frage (s. S. 110/111 und 112):
"Seit Hiob scheitern alle Versuche zu zeigen, dass der Allmächtige, falls er denn existierte, auch noch gut und gerecht sei. Denn wie könnte der Schöpfer Himmels und der Erde, der mächtige Erschaffer von Milliarden Sonnensystemen, wenn er auch noch gütig und gerecht ist, etwa Demenz, Kinderkrebs, Flutkatastrophen oder die verschiedensten Vernichtungslager zulassen, in denen Monster in Menschengestalt ihr Unwesen treiben? Jeder Mensch, sofern er gerecht empfinden kann oder gar gütig ist, würde – wenn er denn die Macht dazu hätte – dem Ausbruch an Zerstörung und roher Gewalt sogleich Einhalt gebieten. Der Allmächtige tut dies aber nicht. Somit sind solche Menschen, und das sind wohl die meisten von uns, offenbar keine Ebenbilder Gottes, der – sollte er denn existieren – dem Treiben auf Erden tatenlos zusieht.
[…]
Am Anfang war das Wort, behaupten die traditionell Glaubenden. Aber das ist falsch, sagen die Empiristen: Am Anfang war und ist nämlich die Erfahrung. Denn die Wahrheit rührt von keinen Autoritäten her, sondern sie ist allein durch genaues Beobachten, gemeinsames, kluges Experimentieren und nüchternes Nachdenken zu erkennen."
Anmerkung
Hervorhebung im Streminger-Zitat stammt vom Autor
der Site.
Beitrag eines römischen
Amtsträgers
Manche werden sich noch an die umstrittene Ernennung des
österreichischen Priesters Gerhard Wagner zum Weihbischof von
Linz erinnern. Joseph Aloisius Ratzinger (*1927)
hatte diesen ultrakonservativen Kleriker Anfang 2009, gegen den
Widerstand österreichischer Bischöfe, ins Bischofsamt gehoben. Wagner
war u. a. dadurch aufgefallen, dass er den Hurrikan Katrina, der in 2005 den
Süden der USA, vor allem New Orleans, verwüstet
hatte, als Strafe Gottes für das sündige Leben der
betroffenen Menschen erklärte. Für Wagner und seine
Gesinnungsgenossen war dieses Naturereignis also Ausdruck der
Gerechtigkeit ihres unendlich gütigen Gottes.
Anmerkung
Dass Wagner, unter dem Druck der Öffentlichkeit und aufgrund
der großen Zahl von Kirchenaustritten, Ratzinger etwa zwei Wochen später
bat, seine Ernennung zurückzunehmen, sei hier lediglich am
Rande erwähnt.
Wagner und andere Ewiggestrige hatten sich schon im Zusammenhang mit der gewaltigen Tsunami-Katastrophe am 2. Weihnachtsfeiertag 2004 ganz ähnlich geäußert. Mehr oder weniger unausgesprochen, hatte damals auch die Theodizee-bezogene Diskussion zeitweise wieder Hochkonjunktur. Ich erinnere mich an eine Fernseh-Runde, in der etwa folgende Fragen aufgeworfen wurden: Wie konnte Gott das zulassen? Warum habe gerade ich einen nahestehenden Menschen verloren? etc. etc. Ich erinnere mich an keine Einzelheiten mehr, aber daran, dass auch der beteiligte führende Theologe einer regionalen evangelischen Kirche keine plausiblen Antworten wusste und einen eher verwaschenen Eindruck hinterließ.
Christliche Theologie, insbesondere in ihrer römischen Spielart, erklärt das Übel bzw. die in der Welt erfahrbaren zahlreichen Leiden insbesondere mit der Sündhaftigkeit der Menschen, die die von ihrem «Gott» gewährte Freiheit missbrauchten.
Viele christliche Theologen und von ihnen (noch) abhängige "Gläubige" wissen(!) auch sehr genau, wer oder was «Gott» ist, kann, will oder nicht will. Und sie wissen meist auch, wann und warum er in das Weltgeschehen oder in Einzelschicksale eingreift oder nicht. Um ihre (Rest-)Unsicherheit bei der Beurteilung göttlichen Verhaltens zu überspielen, äußern sie dann etwa, dass Gottes Wege oder Gedanken andere seien als die der Menschen oder dass wir das Geheimnis Gottes nie ergründen würden etc. etc. Im Übrigen versäumen sie nicht darauf hinzuweisen, dass es, "nach der Wiederkehr des Herrn", im paradiesischen Jenseits die alle irdischen Leiden ausgleichende Gerechtigkeit geben werde.
"Die Natur ist so"
Nach meiner Erinnerung ließ sich der
katholische Theologe Eugen Drewermann
(*1940) in einem Gespräch über die Tsunami-Katastrophe in 2004 nicht
auf eine fruchtlose Theodizee-bezogene Diskussion ein, sondern
erklärte kurz und bündig: "Die Natur ist so".
– Drewermanns
Bemerkung, eine schlichte Binsenweisheit, war immerhin eine
Zeitungsnotiz wert.
Verursacht wurde dieser todbringende Tsunami bekanntlich dadurch, dass sich aufgestaute Spannungen in einer unter dem Indischen Ozean verlaufenden Bruchzone, wo sich die Indisch-australische Platte unter die Eurasische Platte schiebt, plötzlich und schlagartig lösten. Ein Vorgang, der sich auch an anderen Stellen in der Erdkruste immer wieder ereignen kann und tatsächlich ereignet.
Was für Katastrophen verursachende Naturkräfte gilt, gilt in gleicher Weise für Krankheiten und andere "Schicksalsschläge": Sie gehören zu den natürlichen Gegebenheiten der uns umgebenden Welt. Die Tatsache, dass sie von Menschen nicht beherrscht, noch nicht einmal vorhergesehen werden können, führt zu einem Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins: Auslöser für die Suche nach Hilfen jenseits menschlicher Möglichkeiten.
In der Zeit vor der Entwicklung der Naturwissenschaften haben die Menschen Naturphänomene immer mit Dämonen oder Göttern in Verbindung gebracht. Ihnen standen keine anderen Erklärungsmuster zur Verfügung. Kräfte und Eigenschaften, die zuvor auf verschiedene Gottheiten verteilt waren, wurden in Vorderasien vor etwa 3500 Jahren dann auf eine Gottheit projiziert. Das Christentum, das dort seine Wurzeln hat, übernahm vor nahezu zweitausend Jahren diesen Glauben an den einen und einzigen «Gott» und an dessen unüberbietbare Eigenschaften Allmacht, Allweisheit, Allgüte, Gerechtigkeit etc.
Publik-Forum 8·2008 enthielt einen Beitrag des slowakischen evangelischen Theologen Karol Nandrásky (1927-2016). Unter dem Titel Der sich häutende Gott setzte er sich kritisch mit dogmatisch fixierten Glaubenslehren des organisierten Christentums auseinander. Den folgenden Gedankengang daraus finde ich erfrischend klar und einleuchtend:
"Man muss die absurde dogmatische Erklärung abweisen, die in das natürliche Geschehen – als Prinzip der Auslegung der Natur – Gedanken von »Strafe« und »Gerechtigkeit« einträgt. Die Gesetze, die im Naturgeschehen herrschen, »prämieren nicht« und »bestrafen nicht«. Sie sind weder »moralisch« noch »unmoralisch«."
"Es führt kein Weg
zurück …"
Aus den zahlreichen Übeln in der Welt
kann man zwar nicht zwingend ableiten, dass es keinen Gott gibt. Aber
sie nähren große Zweifel an der Existenz jenes
Gottes, den sich die Theologen vor langer Zeit ausgedacht haben und
ihren "Gläubigen" heute immer noch als Grundpfeiler ihres
christlichen Glaubens vermitteln.
Die Theologin Dorothee Sölle (1929-2003) hat dies möglicherweise ähnlich gesehen, als sie in ihrem Buch Atheistisch an Gott glauben festhielt:
"Es führt kein Weg zurück zum Kindervater, der Wolken, Luft und Winden Wege, Lauf und Bahn gibt."
Ich weiß nicht, ob Dorothee Sölle das, was sie in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in ihrem Buch so klar formulierte, auch auf einem Kirchentag jener Zeit geäußert hätte. Auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 in München hat dies jemand mit ganz ähnlichen Worten getan. Wie Publik-Forum in seiner Ausgabe 10·2010 berichtet, fand auf dem Kirchentag, im Zentrum »Juden und Christen im Dialog«, ein Forum unter der Frage »Heute Glauben?« statt. Einer der Teilnehmer war der jüdische Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik (*1947). Publik Forum schreibt darüber u. a.:
"Der Jude, Professor für Pädagogik in Frankfurt, hält es für nicht möglich, »nach den schlimmen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts weiter von einem Gott zu reden, der in der Welt handelt«."
In einer weiteren zitierten Äußerung, einer salopp zugespitzten Formulierung, wird Brumlik noch deutlicher:
»Den Glauben, dass Gott in die Geschichte eingreift, den können wir uns abschminken«.
Fazit
Aus den oben dargestellten Überlegungen
zur sog. Theodizee ergibt sich für
mich zwingend folgende Frage: Die Liebe und die Gerechtigkeit dessen,
den oder was wir »Gott« nennen, sind offenkundig
schon im Diesseits "nicht begründbar und
schlechthin nicht zu halten" (Helmut Groos). Wie
glaubwürdig ist dann die vom Christentum allen "Gerechten" im Jenseits
in Aussicht gestellte Wiedergutmachung –
für die im "irdischen Jammertal" erlittenen Ungerechtigkeiten?
Eine plausible Antwort auf diese Frage fand ich beim Philosophen Joachim Kahl (*1941), in einem Beitrag für die Ausgabe 204 der EZW-Texte:
"Wenn Gott überhaupt einen Zustand ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tod schaffen kann, warum dann so spät und nicht von Anfang an? Warum nur für wenige und nicht für alle? Warum zuvor die eigenen Geschöpfe durch ein Meer von Blut und Tränen waten lassen? Die Antwort kann nur lauten: Lassen wir uns nicht länger von den Hirngespinsten einer religiösen Phantasie in die Irre führen! Statt die Welt zu verrätseln, sollten wir ihr nüchtern ins Angesicht schauen. Oft genug ist die Wirklichkeit bitter. Im Glauben an Gott ist sie bitter und absurd."
Ich stelle fest, dass es sich auch hier, ganz analog zu anderen Themenfeldern christlicher Theologie, um die Diskussion eines künstlich geschaffenen Problems handelt: Ein theologisches Konstrukt genannt «Gott» – Ergebnis theologischer Spekulation – wurde von fantasiebegabten Theologen mit Ehrfurcht gebietenden Attributen ausgestattet. Und letztere erfordern zu ihrer Verteidigung bzw. "Rechtfertigung" ganz zwangsläufig eine Unzahl weiterer Spekulationen – ein absurdes Unterfangen.
![]()
Wichtige
Gedanken über das, was wir
«Gott» nennen, aus den letzten 2500
Jahren
Der vorchristliche griechische Philosoph und Religionskritiker Xenophanes von Kolophon (um 570-um 480 v. Chr.) vertrat die Meinung, nicht die Götter hätten die Menschen erschaffen, sondern die Menschen die Götter. Im Übrigen näherte er sich dem Thema satirisch (gefunden bei Klaus-Peter Jörns):
»Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker, blauäugig und blond.«
»Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten und mit den Händen malen könnten und Bildwerke schaffen wie Menschen, so würden die Pferde die Götter abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die Rinder in der von Rindern, und sie würden Statuen meißeln ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend.«
Beim Historiker Rolf Bergmeier (*1940) fand ich ein Zitat, das die Position des athenischen Philosophen Protagoras (490-411 v.Chr.) zu den "Göttern" widerspiegelt:
»Von den Göttern vermag ich nichts festzustellen, weder dass es sie gibt, noch, dass es sie nicht gibt, noch was für eine Gestalt sie haben; denn vieles hindert Wissen hierüber: die Dunkelheit der Sache und die Kürze des menschlichen Lebens.«
Protagoras weist sich mit dieser Haltung wohl als einer der ersten Agnostiker der Weltgeschichte aus.
Bergmeier erwähnt im selben Zusammenhang auch ein Wort des Stoikers Panaitios:
"Der Stoiker Panaitios (180-110 v. Chr.) ergänzt im zweiten vorchristlichen Jahrhundert: Er selbst komme ganz gut ohne Gott aus, aber wer den allbelebenden, sonnenverwandten Weltgeist (Logos) unter dem Namen Zeus anbeten wolle, solle dies doch gerne tun."
Vom deutschstämmigen
französischen Philosophen Paul Henri
Thiry Baron d'Holbach (1723–1789) ist
eine sehr persönliche Äußerung
über das, was wir »Gott«
nennen, überliefert. In seinem 1770 erschienenen
Werk Système de la Nature schreibt er
(entnommen den 29
Thesen des Materialismus nach d'Holbachs "System der Natur"):
"Wenn ein Gott existierte, wenn Gott ein vernünftiges, gerechtes, gutes Wesen wäre: Was hätte ein tugendhafter Atheist zu fürchten, der, während er im Augenblick des Todes für immer zu entschlafen glaubt, sich einem Gott gegenübergestellt sähe, den er zu seinen Lebzeiten verkannt und missachtet hätte?
»O Gott«, würde er sagen, »der du dich deinem Kinde nicht gezeigt hast! Unvorstellbare Kraft, die ich nicht zu entdecken vermochte! Verzeihe, wenn mein begrenzter Verstand dich nicht hat erkennen können. Konnte ich denn dein spirituelles Wesen, das meine Sinne der Erfahrung nicht unterwerfen konnten, mit ihrer Hilfe ausfindig machen? Mein Geist konnte sich nicht der Autorität einiger Menschen fügen, die über dein Wesen ebenso wenig aufgeklärt waren wie ich und die sich nur darin einig waren, mich herrisch aufzufordern, ihnen die Vernunft, die du mir gegeben hattest, zu opfern. Aber – o Gott – wenn du deine Geschöpfe liebst, so habe ich sie ebenso geliebt wie du. Wenn dir die Tugend gefällt: Mein Herz hat sie immer verehrt. Ich habe den Betrübten getröstet. Niemals habe ich dem Armen das Seinige genommen. Ich war gerecht, gut und mitfühlend«."
Der Philosoph und Religionskritiker Ludwig Feuerbach (1804-1872) bestätigte die Erkenntnis, zu der der griechische Philosoph Xenophanes von Kolophon schon etwa 2300 Jahre vor ihm gelangt war (s. oben):
"Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch schuf, wie ich im Wesen des Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde."
Der Theologe Franz Overbeck (1837-1905) betrachtete gegen Ende seines Lebens den "Gott des Christentums" auf satirisch-kritische Weise. Seine unnachahmliche Würdigung ist dem aus seinem Nachlass herausgegebenen Buch Christentum und Kultur entnommen:
"Der Gott des Christentums ist der Gott des Alten Testaments. In seiner reifen Jugend verkündeten Himmel und Erde die Ehre dieses Gottes. Kein Wunder, dass er sich allmählich zu einem Sultan auswuchs, der sich im Alter die Zeit damit vertrieb, eine Vasensammlung anzulegen und die ihm zusagenden Töpfe durch Aufnahme in die Sammlung zu »ehren«, die anderen, die meisten, denn es gefielen ihm wenige, zu zerschlagen. Diese Geschichte hat dieser Gott, wie alle seinesgleichen die ihrige, nur in den Köpfen seiner Verehrer erlebt. Man denke aber bei dieser Geschichte an die der vielen kleinen Götter, die in den Köpfen der Menschen groß werden, und was aus ihnen schließlich im Dunste des ihnen gespendeten Weihrauchs werden mag."
Friedrich Nietzsche (1844-1900), der mit dem Theologen Franz Overbeck (s. o.) eng befreundet war, äußerte sich im 18. Kapitel seines Buches Der Antichrist über den "christlichen Gottesbegriff":
"Der christliche Gottesbegriff – Gott als Krankengott, Gott als Spinne, Gott als Geist – ist einer der korruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind; er stellt vielleicht den Pegel des Tiefstands in der absteigenden Entwicklung des Götter-Typus dar. Gott zum Widerspruch des Lebens abgeartet, statt dessen Verklärung und ewiges Ja zu sein. In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben die Feindschaft angesagt! Gott die Formel für jede Verleumdung des »Diesseits«, für jede Lüge vom »Jenseits«! In Gott das Nichts vergöttlicht, der Wille zum Nichts heilig gesprochen!"
Dem Physiker Albert Einstein (1879-1955), ebenso wie anderen großen Wissenschaftlern, wurde und wird immer wieder eine besonder Beziehung zu dem, was wir «Gott» nennen, nachgesagt. Dies geschieht meist mit dem Hinweis, dass diese großen Forscher bei ihrem Vorstoss in die Tiefen der atomaren Strukturen unseres Kosmos ganz persönliche "Gotteserfahrungen" gemacht hätten. Bei Albert Einstein wird dies häufig festgemacht an dem Zitat "Gott würfelt nicht". Es handelt sich um eine Verkürzung von Gedanken Einsteins in einem Brief an seinen Physikerkollegen Max Born (1882-1970) (s. hier). Das Einsteinsche Gottesverständnis lässt sich daraus schwerlich zweifelsfrei ableiten. Tatsächlich hat sich Einstein gegen das in der Öffentlichkeit gezeichnete Bild seiner "religiösen Überzeugungen" gewehrt. In einem Brief vom 24. März 1954 schrieb er:
"Es war natürlich eine Lüge, was Sie über meine religiösen Überzeugungen gelesen haben, eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es deutlich ausgesprochen. Falls es in mir etwas gibt, das man religiös nennen könnte, so ist es eine unbegrenzte Bewunderung der Struktur der Welt, so weit sie unsere Wissenschaft enthüllen kann."
In einem Brief, den er am 3. Januar 1954 an den Philosophen Eric Gutkind geschrieben hatte, sind weitere kritische Anmerkungen zur Religion enthalten:
"Das Wort Gottes ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden, welche doch ganz schön kindisch sind. Keine Interpretation, wie feinsinnig sie auch sein mag, kann das (für mich) ändern. [...]
Für mich ist die jüdische Religion wie jede andere der Inbegriff des kindischsten Aberglaubens."
Anmerkung
Die vorausgehenden Einstein-Zitate fand ich hier.
Im Buch Woran glaubt ein Atheist? des französischen Philosophen André Comte-Sponville (*1952) stieß ich auf ein Zitat, dass zeigt, wie souverän Einstein auf eine sehr persönliche, naiv gestellte, Frage reagierte:
Da über das, was wir «Gott» nennen nichts Konkretes oder Nachprüfbares ausgesagt werden kann, ist der Begriff seit jeher fantasievollen Spekulationen ausgesetzt. Ein einheitliches Verständnis gibt es nicht. Das konnte selbst durch die von der "Offenbarungsreligion" Christentum verkündeten Dogmen nicht erreicht werden. Daher war diese nüchterne Reaktion für den Physiker Einstein wohl die einzig plausible.
In seinem Buch Gott ist anders zitiert der anglikanische Bischof A. T. Robinson (1919-1983) eine Äußerung des englischen Biologen, Philosophen und Schriftstellers Julian Huxley (1887-1975):
»Die Hypothese 'Gott' hat heutzutage keinen Nutzwert mehr für die Erklärung der Natur, sie steht nur allzu oft einer besseren und genaueren Erklärung im Wege. Gott lässt sich heute eher mit einem kosmischen Fabelwesen vergleichen als mit der Gestalt eines Herrschers.
Für einen gebildeten Menschen wird der Glaube an einen solchen Gott bald ebenso unmöglich sein wie der Glaube daran, dass die Erde eine Scheibe ist, dass Fliegen aus dem Nichts entstehen, dass Krankheit eine göttliche Strafe ist oder dass der Tod etwas mit Zauberei zu tun hat. Götter wird es allerdings immer geben, einmal, weil ganz bestimmte Leute an ihnen interessiert sind, oder weil träge Gemüter ihnen Unterkunft in ihrem Denken gewähren, oder sie werden von Politikern als Werkzeuge gebraucht oder sie dienen als Refugium für unglückliche und einfältige Menschen.«
Erich Fromm (1900-1980), der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe, analysierte im Rahmen seines umfangreichen Werkes u. a. die Entwicklung des Gottes- und des Menschenbildes im Verlaufe der jüdischen Geschichte (s. hier). Seine Gedanken regen dazu an über entsprechende Entwicklungen im Christentum nachzudenken. Grundlage für das christliche Gottesbild war schließlich der jüdische Monotheismus.
"Die Entwicklung des Gottesbildes und des Menschenbildes beginnt im Alten Testament mit einem autoritären Gott und einem gehorsamen Menschen. Doch selbst in dieser autoritären Struktur sind die Samen von Freiheit und Unabhängigkeit bereits zu finden. Von allem Anfang an soll man Gott aus keinem anderen Grund gehorchen, als dass man daran gehindert werden soll, Götzen zu gehorchen. Die Verehrung des einen Gottes bedeutet die Negierung der Verehrung von Menschen und Dingen.
In der Entwicklung der biblischen und nachbiblischen Gedanken kann man verfolgen, wie dieser Same sich weiter entwickelt. Gott, der autoritäre Herrscher, wird zu einem konstitutionellen Monarchen, der selbst an die von ihm verkündeten Grundsätze gebunden ist. Aus dem anthropomorph geschilderten Gott wird ein namenloser Gott und schließlich ein Gott, von dem keine Wesensattribute auszusagen sind. Der Mensch wird aus einem gehorsamen Diener zu einem freien Menschen, der seine Geschichte selbst macht, ohne das Gott in sie eingreift, und der einzig geleitet wird von der prophetischen Botschaft, die er entweder annehmen oder verwerfen kann.
Der Möglichkeit, sich den Menschen unabhängig von Gott vorzustellen, waren jedoch Grenzen gesetzt; das gleiche gilt für die Möglichkeit, den Gottesbegriff selbst völlig aufzugeben. Die alten Vorstellungen sind für eine Religion, welche Formulierungen für ein einigendes Prinzip und Symbol zu finden sucht, mit dem sie ihre Struktur «zementieren» und ihre Gläubigen zusammenhalten kann, nur natürlich. Daher vermochte die jüdische Religion den letzten logischen Schritt nicht zu vollziehen, «Gott» aufzugeben und ein neues Bild vom Menschen zu errichten als einem Wesen, das auf dieser Welt allein ist und sich trotzdem auf ihr zu Hause fühlen kann, wenn es ihm gelingt, mit seinen Mitmenschen und mit der Natur zur Harmonie zu gelangen."
Anmerkung
Hervorhebung im
vorausgehenden Zitat
stammt vom Autor der Site.
Bei Erich Fromm (1900-1980) fand ich auch eine plausible Vorstellung von der Gefahr der "Entfremdung des Menschen von seinen eigenen Kräften" (s. hier) durch den Glauben an das, was wir «Gott» nennen:
"Die Entfremdung von seinen eigenen Kräften gibt dem Menschen nicht nur das Gefühl sklavischer Abhängigkeit von Gott; sie macht ihn sogar schlecht. Er wird ein Wesen ohne Glauben an seine Mitmenschen oder an sich selbst, ohne Erfahrung seiner eigenen Liebeskraft und seines eigenen Vernunftvermögens. Die Folge ist die Trennung zwischen dem «Heiligen» und dem «Weltlichen». In seinem weltlichen Tun handelt der Mensch ohne Liebe; in jenem Bezirk seines Lebens, der der Religion vorbehalten ist, fühlt er sich als Sünder (der er auch ist, denn ohne Liebe leben heißt in Sünde leben) und versucht, etwas von seiner verlorenen Menschlichkeit durch die Gottbeziehung zurück zu gewinnen. Gleichzeitig müht er sich um Vergebung, indem er seine eigene Hilflosigkeit und Unwürdigkeit bekennt. So artet sein Streben, Vergebung zu erwerben, gerade in jene Haltung aus, aus der die Sünde stammt. Er ist in ein schmerzliches Dilemma geraten. Je mehr er Gott preist, desto leerer wird er. Je leerer er wird, desto sündiger fühlt er sich. Und je sündiger er sich fühlt, desto mehr preist er seinen Gott – und desto weniger ist er imstande, zu sich selbst zurückzufinden."
Im Kapitel Das Christentum oder die Verewigung einer frühen Theologie seines Buches Die Zukunft des Unglaubens schreibt der Philosoph und Schriftsteller Gerhard Szczesny (1918-2002):
"Die Läuterung des zornigen und gewalttätigen Stammesgottes der Juden zum milden Patriarchen und Vater der Christen ändert nichts am Grund-Wesenszug dieses Gottes. Er ist und bleibt ein außerhalb des Weltzusammenhanges beheimateter Dämon, dessen unerforschliche Entscheidungen den Menschen an seine Nichtigkeit erinnern. Da aber die Völker ihre Religionen nicht erdenken, um sich ihrer Verlorenheit zu vergewissern, sondern um der Ohnmacht und dem Elend ihrer Existenz zu entkommen, musste zwischen dem unbegreiflichen Herrscher-Gott und den Angehörigen des von ihm auserwählten Volkes die Möglichkeit einer Kommunikation gefunden werden. Gott wurde der Wille zugeschrieben, sich einzelnen, besonders begnadeten Menschen gelegentlich aus unbekannten Gründen und unter mysteriösen Umständen kundzutun."
Die katholische Theologin Uta Ranke-Heinemann (*1927) kritisiert in ihrem Buch Nein und Amen die Überschreitung naturgegebener Grenzen menschlicher Vernunft und Erkenntnisfähigkeit bei der dogmatischen Fixierung des christlichen Gottesbildes. Sie beschreibt ihre Sicht so:
"»Das, was man von Gott erkennen kann [...], ... wird seit Erschaffung der Welt an den Werken der Schöpfung durch das Denken wahrgenommen«, sagen also die Christen selbst, weil es in ihrer Bibel steht. Aber sie halten sich nicht daran. Den Christen genügt solche Gotteserkenntnis nicht. Sie wollen mehr von Gott erkennen, als man von Gott erkennen kann. Sie wollen nicht die gottgegebenen Naturgesetze denkend wahrnehmen, sondern an Wunder glauben. Darum errichten sie ihr christliches Märchengebäude und schauen sogar hinter das Universum direkt auf Gott selbst, ja sogar in Gott hinein (Dreifaltigkeit). Jedenfalls behaupten sie, das zu können, dank ihrer christlichen Sonderoffenbarung.
Nun darf zwar jeder Mensch so viel fantasieren wie er will. Aber er darf nicht sein Phantombild Gottes allen anderen Menschen aufdrängen."
Der ehemalige katholische Priester und Hochschullehrer Peter de Rosa (*1932) befasste sich u. a. mit dem Gottesverständnis des "modernen Menschen" und mit dem "Reden über Gott":
"Was Nietzsche mit prophetischer Deutlichkeit sah, war, dass die Welt, wie sie gegenwärtig verstanden wird, den modernen Menschen daran hindert, an den Gott der Vergangenheit zu glauben. Im vorwissenschaftlichen Zeitalter war es möglich, an einen Gott zu glauben, der sich auf Gebete oder die Bedürfnisse seiner Gläubigen hin einmischte. Doch das ist vorbei. »Dass kleine Mucker und Dreiviertels-Verrückte sich einbilden dürfen, dass um ihretwillen die Gesetze der Natur beständig durchbrochen werden – eine solche Steigerung jeder Art von Selbstsucht ins Unendliche, ins Unverschämte kann man nicht mit genug Verachtung brandmarken.« (Antichrist, 43.). […]
Unser Ziel ist nicht, das Reden über Gott abzuschaffen, sondern seine Unzulänglichkeit bewusst zu machen und seine Eignung anhand seiner Fähigkeit zu beurteilen, uns mit unseren Mitmenschen und dem Universum in Harmonie zu bringen.
Es gibt zum Beispiel einen tiefen moralischen Aspekt im Gottesglauben. Grausamkeit, Gier, Mord, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und so fort spiegeln Gott nicht, denn sie sind nicht in Harmonie mit dem Universum; sie zerstören unser Zuhause und unsere Beziehungen zueinander."
Der katholische Theologe und Kirchenkritiker Horst Herrmann (1940-2017) beteiligte sich an dem von Karlheinz Deschner (1924-2014) herausgegebenen Buch Woran ich glaube. In seinem Beitrag wird u. a. sein Gottesverständnis deutlich. Darüber hinaus bringt er darin die Hoffnung auf einen veränderten Umgang mit dem, was wir «Gott» nennen, zum Ausdruck:
"Ich hoffe, dass der willfährig gottlose Gott, den sich die Kleriker gehalten haben, nicht mehr als Möglichkeit zur Befreiung des Menschen ausgegeben werden kann. Von einem solchen Gott kommt keine Freiheit. Er ist, selbst Schöpfung aus Angst, Mit-Schöpfer erniedrigender Angst unter den Menschen."
![]()
Schlussbemerkungen
»Ebenbildlichkeit«
von «Gott» und dem Menschen?
Ein weiteres Wort von Erich Fromm (1900-1980)
über das was wir «Gott»
nennen empfinde ich, auf dem Weg zur eigenen
Positionsbestimmung, als sehr hilfreich:
"«Gott» ist für mich eine der vielen poetischen Ausdrucksweisen für den höchsten Wert im Humanismus und keine Realität an sich."
Nicht zuletzt dieser Gedanke Erich Fromms lässt mir jenen, im organisierten Christentum, immer noch weit verbreiteten infantilen Glauben an die "Ebenbildlichkeit" von «Gott» und dem Menschen als völlig absurd erscheinen. Diese aus der jüdischen Mythologie, einer längst vergangenen archaischen Zeit, übernommene Vorstellung war mitverantwortlich für die Herausbildung der Illusion, der Mensch stünde im Zentrum des Universums und könne über alles um ihn herum nach Gutdünken verfügen – eine wahnwitzige christliche Glaubensmeinung von dogmatischem Rang und mit katastrophalen Folgen.
Dieses infantile anthropozentrische Weltbild ist in Verbindung mit den nicht weniger infantilen christlichen Erwähltheitsfantasien ganz wesentlich mitverantwortlich für den egoistischen, rücksichtslosen Umgang des Menschen mit seinen Mitgeschöpfen und mit den begrenzten Ressourcen der Erde. Um den längst absehbaren verheerenden Folgen dieses Verhaltens für die Zukunft der Natur und der Menschheit entgegenzuwirken, bedarf es dringend eines grundlegenden Wandels des kollektiven Bewusstseins oder anders ausgedrückt: eines umfassenden Paradigmenwechsels.
In Gedanken Erich Fromms findet sich so etwas wie eine Vision von diesem überlebenswichtigen Paradigmenwechsel. Diese Vision taucht bei ihm auf im Zusammenhang mit der Beschreibung der Entwicklungsgeschichte des jüdischen Gottesbildes (s. oben). M. E. lässt sich aus seinen Worten eine plausible Handlungsempfehlung ableiten für den unabdingbaren Paradigmenwechsel. Diese Empfehlung bedeutet nicht weniger als
"[...], «Gott» aufzugeben und ein neues Bild vom Menschen zu errichten als einem Wesen, das auf dieser Welt allein ist und sich trotzdem auf ihr zu Hause fühlen kann, wenn es ihm gelingt, mit seinen Mitmenschen und mit der Natur zur Harmonie zu gelangen."
Anmerkungen
- Ein Kuriosum am Rande: die persönliche
Glaubensmeinung des "Apostels" Paulus zur "Gottebenbildlichkeit". (s. hier)
- Ein weiteres Argument gegen die
Gottebenbildlichkeit: s. oben
Abschied
Ich habe nichts gefunden, womit dieses Kapitel angemessener beendet
werden könnte, als mit den letzten Sätzen aus dem
Buch Gottesvergiftung
des Psychoanalytikers Tilmann
Moser (*1938). In Ihnen kommt eine Haltung zum Ausdruck, zu
der Moser nach sehr schmerzhaften persönlichen Erfahrungen
gelangt war. Mich beeindrucken insbesondere seine nüchterne,
aufgeklärte und überzeugende Art und Weise, mit der
er vom tradierten Gottesverständnis Abschied nimmt, sowie sein
optimistischer Blick in die Zukunft, in eine Zukunft ohne
"Krücke":
"Aber ich wollte dir ja sagen, inwieweit du, die große Krankheit, auch dein Gutes gehabt hast: Dich überstanden zu haben gibt mir Selbstbewusstsein; von der riesigen Krücke nicht erschlagen worden zu sein, ein Gefühl von Kraft. Zutrauen werde ich nie mehr zu dir haben können. Aber ich weiß auch, dass du anderen freundlicher begegnet bist. Soweit sie dich brauchen, um nicht noch mehr zu leiden, werde ich nicht gegen dich sprechen. Es genügt mir, dass ich dich nicht mehr brauche. Wie viel Gewicht dir andere belassen wollen, darin will ich ihnen nicht dreinreden.
Aber was wird an deine Stelle treten, die riesigen Leerstellen füllen, wo du dich ausgebreitet hattest? Nicht alle müssen gefüllt werden. Das Haus kann schrumpfen, es war unnötig groß. Und was du für dich an wunderbaren Eigenschaften gepachtet hattest, werde ich bei den Menschen wiederfinden. Wenn ich in manche Gesichter sehe, empfinde ich keinen Verlust mehr, und menschliche Gesichter werden deines ersetzen, weil deines unmenschlich war. Meine Augen lernen sehen, seit du mir nicht mehr den Horizont verdunkelst."
